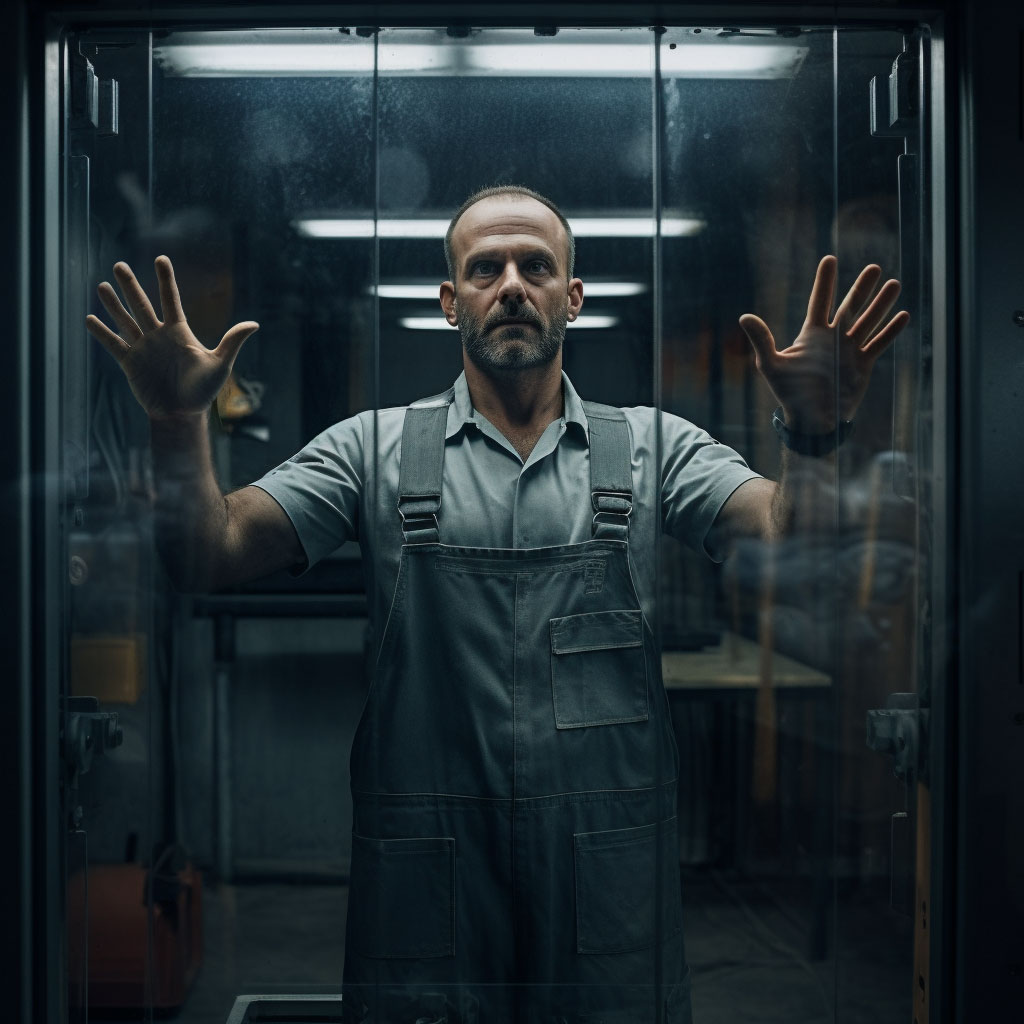Ich habe gerade die Ello-App von meinem iPhone gelöscht, denn das gleichnamige Social Network ist anscheinend tot. Da die URL komplett unerreichbar ist, gab es keine Möglichkeit, meinen dortigen, aber auch schon lange brachliegenden Account aktiv zu löschen. Nun ja. Auch von Twitter verabschiede ich mich derzeit auf Raten. @wortgeburt wurde bereits archiviert, transferiert und anschließend gelöscht, das Tweet-Archiv meines Hauptaccounts @formschub habe ich vor ein paar Tagen voraussichtlich letztmalig angefordert und heruntergeladen. Ich bin dort zwar noch angemeldet, lese gelegentlich mit und hefte hier und da ein Sternchen an einzelne Tweets, ganz selten retweete ich noch, aber die Luft ist raus, der Spaß ist weg. Die gelegentlichen Besuche hinterlassen ein Bild von irgendwas zwischen einem trotzig besetzten Gallischen Dorf, einer in nostalgischen Pastelltönen verbleichenden Geisterstadt und einer misanthropen Kloake. Ein anderes Social Network, das ich so gut wie gar nicht (mehr) nutze, ist XING. Ich war dort mal in einigen User-Gruppen recht aktiv, habe Kontakte zu netten Kunden und Weggefährten gesammelt und gehortet und sogar hin und wieder für meine Jobprojekte einzelne sehr kompetente und nette Freelancer rekrutieren können (das ist auch der Hauptgrund, aus dem ich den Account zwecks künftiger Nutzung noch behalte), aber ich könnte nicht aus dem Stegreif sagen, wann ich mich dort zum letzten Mal eingeloggt habe.
Notgedrungen wieder etwas aktiver geworden bin ich dafür bei LinkedIn. Im Mai 2023 hatte unsere Agentur ein maritimes Wirtschaftsevent in Hamburg gesponsert und das nahm ich einige Wochen vorher zum Anlass, meinen dort ebenfalls schon vorhandenen schlafenden Account wieder zu reaktivieren. Man will ja nicht den Eindruck einer Karteileiche erwecken, wenn ein Konferenzteilnehmer einem anhand der überreichten Visitenkarte hinterherrecherchiert und nur Gestriges vorfindet. Aber was sollte ich dort schreiben? Eine Präsenz auf mehreren parallelen Social-Media-Plattformen erfordert ja grundsätzlich Antworten auf vielfältige Fragen: Kann mir dieses Netzwerk etwas bieten oder nutzen, »gehöre« ich dorthin, bin ich dort richtig? Habe ich generell (zusätzlich zu meiner Präsenz auf anderen Plattformen) die Zeit und die Lust, dort aktiv zu sein, Inhalte zu erstellen, zu konsumieren oder zu teilen, Kontakte zu knüpfen oder mit anderen Mitgliedern über Likes und Kommentare zu interagieren? Und letztlich: WAS kann oder will ich dort überhaupt veröffentlichen? Hat es Sinn, Beiträge von anderen Plattformen zu crossposten, Fremdbeiträge zu teilen oder möchte ich selber neuen, eigenen Content kreieren? Wie viel Aufwand, Recherche, Ideen will und kann ich dafür investieren? Kann ich Inhalte bieten, die nicht in ähnlicher Form oder mit gleicher Thematik schon von ’zig anderen Usern gepostet wurden? Wie »privat« oder wie »beruflich« gebe ich mich auf den verschiedenen Plattformen?
Ich persönlich fühle mich auf den eher »privaten« Plattformen deutlich wohler als auf primären Businessportalen. Ich habe einerseits keine Lust, mich auf Plattformen, auf denen ich täglich Zeit verbringe, zu verstellen oder mich anders darzustellen, als ich bin. Andererseits habe ich aber auch keine Lust, allzuviel Privates von mir preiszugeben. Seit ich im Internet unterwegs bin, versuche ich, meine privaten und meine beruflichen Präsenzen weitgehend getrennt zu halten. Ich thematisiere auf meinen privaten, informellen Accounts oder in diesem Blog so gut wie nie meine Firma, Kunden oder Agenturprojekte und verlinke auch nicht dorthin. Umgekehrt verweise ich auf Business-Plattformen nicht auf mein Blog oder meine privaten Social-Media-Accounts. Ich mache zwar mit dem iPhone öfter mal Selfies, aber ich poste sie so gut wie nie. Jemand, der mir von meinen privaten Accounts aus hinterherrecherchiert, wird zwar irgendwann Fotos von mir entdecken können, aber ein bisschen Arbeit darf das schon machen. Auf den Business-Accounts bin ich zwar mit Klarnamen und Profilbild präsent, aber von dort aus führen keine breiten beleuchteten Pfade zu Twitter bzw. inzwischen zu Mastodon oder Bluesky.
Warum mache ich das so? Meine Grunderfahrung auf den privaten Plattformen ist, dass mit mir anders umgegangen wird, wenn mein Gegenüber nur wenige persönliche Informationen von mir hat und der Rest des Bildes, das er/sie von mir hat, allein in seinem/ihrem Kopf auf Grundlage des Contents entsteht, den ich produziere. Es bleibt zunächst im Dunkeln, wie alt ich bin, ob ich männlich, weiblich oder divers bin, wo ich wohne, welchen Beruf oder welche Hautfarbe ich habe usw. Das empfinde ich auch im Falle verbaler Angriffe als Vorteil, denn die Unschärfe, die ich auf diese Weise aufrechterhalte, bietet weniger Angriffsfläche und beschränkt einen Wortwechsel stärker auf Inhalt und Formulierung der Kommunikation als auf Projektionen, Rollenbilder, Vorurteile oder Erwartungen, denen ich durch eine Preisgabe persönlicher Details den Weg bereiten würde. Ich selbst mag das auch bei anderen Usern. Auf Twitter habe ich mal geschrieben, »Twitter ist der tollste Ort, um Gleichaltrige zu treffen, selbst wenn sie Jahre früher oder später geboren sind als man selbst«. Ich finde es großartig, wenn ich einen Menschen, dem ich online begegne, allein danach beurteilen darf, was er oder sie mir mitteilt. Ich lese die Person und bewerte sie nur auf dieser Grundlage als interessant, amüsant, liebenswert, scharfsinnig, kompetent oder empathisch, ich muss sie nicht sehen oder in eine Kategorie einsortieren, nur weil ich ihre biografischen Details kenne. Ich schaue mir selten Avatarbilder in vergrößerter Darstellung an und mag abstrakte oder illustrative Avatarbilder viel lieber als fotografische Portraits. Auch ein Grund, warum ich auf meinen privaten Accounts seit jeher mit meiner »Ente« unterwegs bin. Die wechselt zwar hin und wieder Thema oder Farbe, aber sie ist mein »Markenzeichen« anstelle eines Gesichtsbildes. Die Ente ist ein friedliebendes Tier. Sie sieht hübsch und freundlich aus, kann zu Wasser, zu Land und in der Luft unterwegs sein, sie attackiert niemanden, greift keine anderen Tiere an und macht nette Geräusche, die sich im Rahmen von Zimmerlautstärke bewegen. Das macht sie mir ein wenig ähnlich und vermutlich deshalb als Repräsentanten auch so anhaltend sympathisch. Auch ich bin ein eher introvertierter, stiller Mensch, suche mir meine wenigen Freunde sorgsam aus, bin wenig risikoaffin, bleibe lieber allein als mich mit der »falschen« Gesellschaft zu umgeben und bin gegenüber Fremden eher schüchtern, was sich aber schnell ändern kann, wenn gegenüber einer »neuen« Person ein Gefühl der Vertrautheit und des Vertrauens entsteht. Ich höre lieber zu und schweige sehr lange, und wenn ich dann etwas sage, meist erst, wenn ich der Meinung bin, nun genug zu wissen, um etwas Neues beitragen zu können oder weil ich eine Frage habe. Ich formuliere in Wort und Text sehr bedacht, das führt oft zu sehr knappen Äußerungen, was mir bisweilen von Menschen, die mich (noch) nicht so gut kennen, fälschlicherweise als Arroganz ausgelegt wird, dabei ist meine Intention lediglich, effizient zu kommunizieren und so weit wie möglich Missverständnisse zu vermeiden. Denn ich verbringe viel lieber Zeit damit, interessante Gespräche zu führen als darüber zu reden, was ich wie gemeint haben könnte oder eigentlich sagen wollte. »Effizienz ist die edelste Art der Faulheit«, hatte ich irgendwann mal gepostet und das beziehe ich auch ausdrücklich auf Sprache und Kommunikation. Ich mag keine Schwätzer und Dampfplauderer und möchte auch selbst keiner sein. Darauf komme ich gleich noch mal zurück.
Beim Verfassen und Vorbereiten dieses Blogbeitrags stieß ich auf eine unbeantwortete Frage, die mir ein User auf Mastodon schon im Februar stellte und die mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist: »Was bedeutet eigentlich Dein Nickname formschub?« Auch das kann ich gerne hier mal beantworten. 2005 oder 2006 wollte ich mich beruflich verändern und begann im Rahmen meiner Bewerbungsinitiativen damit, mir meine erste eigene Website zu bauen. Ich wollte dort mein Portfolio als Grafik-Designer präsentieren und suchte natürlich zuerst nach einem Namen für eine geeignete Domain. Bei der Recherche nach sowohl ungewöhnlichen als auch deutschsprachigen Begriffen rund um das Assoziationsfeld »Gestaltung«, »Formgebung«, »Design« stieß ich auf das im Sportbereich ab und zu genutzte Wort »Formschub« (englische Begriffe fand ich zu prätentiös, obwohl oder vielleicht gerade weil sie in der Werbe[r]szene sehr populär sind). Das Wort bezeichnet einen plötzlichen Anstieg der Leistungsfähigkeit von Athleten, wenn sie kurz vor einem Wettkampf noch einmal besonders intensiv und konzentriert trainieren (z.B.: »Ein Trainingslager in Neuß während der Osterferien brachte für Sophia Schmidt einen weiteren Formschub«). Aber ich interpretierte es visuell – als den Schub, den ich der graphischen Form (also dem Design) mit meiner Arbeit geben möchte. Zudem wurde das Wort sowohl im Sport und erst recht darüber hinaus ziemlich selten benutzt, so dass die Domain noch frei war und die generelle Auffindbarkeit im Netz damit begünstigt wurde. Und da lag es natürlich nahe, den Namen auch für mein erstes Blog auf dieser Domain und die alsbald erstellten ersten und nachfolgenden Social-Media-Profile zu nutzen. Ich glaube, ich habe den Begriff inzwischen recht erfolgreich »gekapert«, wenn ich mir so die aktuellen Suchergebnisse anschaue. 🙂
Ach ja, LinkedIn. Vor ein paar Tagen las ich einen kommentierenden Artikel bei heise.de mit der Überschrift »Wie LinkedIn das neue Facebook – und dann cool wurde«. Naja. »Cool« ist dort aus meiner Sicht nicht wirklich viel. Aber da ich mich entschieden habe, dort mit einem gewissen Grundrauschen in beruflicher Mission präsent zu sein, muss ich mir natürlich auch überlegen, womit. Nach einigen Wochen mit teils etwas längeren, aufwendigeren oder rechercheintensiveren Beiträgen merkte ich, dass mir das auf Dauer zu anstrengend ist, auch im Hinblick auf die überschaubare Anzahl der Leser, denn ich bin auch eher zurückhaltend mit der Praxis des Vernetzens auf Businessportalen. Ich vernetze mich entweder mit Leuten, mit denen ich beruflich vor der Vernetzung persönlich in Kontakt gekommen bin oder mit Menschen, auf deren Erfahrung und Kompetenz ich bevorzugt in meinem Job oder bei einzelnen Projekten zurückgreife. Und sie müssen nett sein, sonst wird das nix. Wenn die Chemie nicht stimmt oder Allüren wichtiger als Teamwork sind, bleibt jede (insbesondere kreative) Zusammenarbeit nach meiner Erfahrung weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Darauf habe ich keine Lust. Andere XING- oder LinkedIn-Mitglieder sehen das anscheinend weniger eng. Mindestens einmal die Woche erhalte ich Nachrichten oder Kontaktanfragen von frappanter Beliebigkeit, etwa »Hey, ich habe gesehen, du atmest auch Sauerstoff und gehörst zur Spezies Homo sapiens – und da dachte ich, wir haben so viel gemeinsam, dass ich mich gern mit dir vernetzen möchte!« Ja. Du. Ich nicht.
Mir fehlt auch das Talent, mich im Voraus wirksam zu verkaufen. Ein Grund, warum ich auch auf Live-Business-Netzwerktreffen sehr selten anzutreffen bin. Beruflicher Smalltalk ist mir ein Graus, insbesondere mit Menschen, denen ich neu begegne. Wenn ich frühere kreative Arbeiten oder abgeschlossene Projekte präsentieren kann, die ich selbst mitgestaltet habe, bin ich in meinem Element. Denn dann kann ich über etwas sprechen, was ich bereits geleistet habe, über eine Aufgabe, die ich gemeistert habe, eine Lösung, die ich für ein gestalterisches Problem fand, über fachliche Aspekte, mit denen ich mich auskenne. Aber vorab jemanden zu umwerben, mit nichts als einer Visitenkarte und wohlgewandten warmen Worten, das will mir nicht so recht gelingen. Deshalb gehe ich solchen Situationen lieber aus dem Weg – darin sind meine Kollegen wesentlich besser. Und da ich halt kein »Schwätzer« bin (siehe oben), fehlt mir auch der Drang, mich auf LinkedIn mit meinen beruflichen Tätigkeiten oder Skills permanent selbst darzustellen oder zu feiern. Ich will keine Whitepaper schreiben oder »einen vom Pferd erzählen«, doch das erschwert wiederum die Themensuche für eigene Postings. Ich möchte den Lesern auf dem Portal zwar Dinge nahebringen, die sie womöglich noch nicht wissen, die interessant sind, die sie amüsieren oder überraschen und die sie idealerweise so auf anderen Profilen nicht ebenfalls vorfinden, aber ich mag dabei nicht posen, blenden oder (man)splainen.
Dann kam mir die Idee, eine regelmäßige Posting-Kategorie zu etablieren, die sich einem Thema widmet, das mich sowohl privat als auch beruflich begeistert: Typographie. Seit einigen Monaten gibt es daher nun auf meinem LinkedIn-Profil die Rubrik »Typographisches Fundstück der Woche« unter dem dafür erdachten Hashtag #tyfudewo. Als konstanten Stichtag für die wöchentlichen Beiträge wählte ich den Freitag, denn da steht das Wochenende vor der Tür und viele Büromenschen sind an diesem Tag etwas entspannter und feuilletonaffiner als an den Werktagen davor. Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte habe ich auf all meinen Wegen und Reisen einen ansehnlichen Foto-Fundus typographischer Fundstücke angehäuft und ständig kommen neue hinzu. Damit habe ich genug Stoff auf Jahre hinaus, kann zu einzelnen Motiven kleine Anekdoten oder Hintergrundinformationen liefern, muss mir wenig Gedanken um neue Themen machen, muss nicht lange recherchieren, bin fachlich sattelfest und kann zugleich auch meine eigene berufliche Kompetenz einbringen. Win-win.
Und manchmal finde sogar ich durch eins meiner eigenen Postings noch Dinge heraus, die ich bislang noch nicht wusste. Als ich heute meinen nächsten LinkedIn-Beitrag für Freitag vorbereitete, wählte ich ein Foto, das ich vor 15 Jahren in einer Seitenstraße in Berlin geknipst hatte. Ich fuhr damals zufällig dort mit dem Fahrrad an einem Schaufenster vorbei, durch das man in einen großen leeren Raum sehen konnte. Auf dem Boden darin lag knapp ein Dutzend großer gelber Leuchtbuchstaben, die wohl zuvor zwecks Ausmusterung von einer Fassade oder einem Dach abmontiert worden waren und nun in dieser provisorischen Lagerstätte ihrer Entsorgung zu harren schienen. Auf meiner Festplatte trägt die Bilddatei den Namen »CIMG3710_Typofriedhof.jpg«. Für was die Buchstaben einst warben, wusste ich nicht. In der Nähe der Fundstelle war ich damals selten unterwegs und erinnerte mich nicht daran, welche Leuchtreklamen die Gebäude in der Gegend trugen.

Heute versuchte ich nachträglich, für meinen kurzen Posting-Text dann doch noch die Herkunft der gelben Lettern zu erkunden, machte mir aber anderthalb Jahrzehnte nach der Entstehung des Fotos nur wenig Hoffnungen. Doch siehe da: es gab eine Überraschung! Ich stieß nach einigen Recherchen auf einen Beitrag, in dem die abgenommenen Buchstaben ebenfalls erwähnt wurden. Ein A konnte damals vor der Vernichtung bewahrt werden und wurde in die Sammlung des Berliner Buchstabenmuseums aufgenommen. Und nachdem ich nun den Namen des werbetreibenden Unternehmens kannte – es war das ehemalige Modekaufhaus EBBINGHAUS am Spittelmarkt und einst der größte Textilfilialist Berlins, fand ich bei Wikipedia ein Foto des Gebäudes mit der intakten Beschriftung, wohl kurz vor der Demontage. Das Gebäude wurde kurz darauf abgerissen, vielleicht stand es bereits an dem Tag schon nicht mehr, als ich die ausgemusterten Buchstaben vorfand. Kurios ist, dass die Reihenfolge der abgelegten Buchstaben im obigen Bild sogar noch annähernd mit derjenigen im ursprünglichen Namen übereinstimmt und hinten an der Wand lehnt tatsächlich auch das vom Museum adoptierte A.

Und so werden Gebäude abgerissen und weichen neuen Bauwerken, genauso wie Social-Media-Portale verwaisen oder degenerieren und andere ihren Platz einzunehmen versuchen. Und ich habe durch die Aufbereitung eines kleinen LinkedIn-Beitrags eine 15 Jahre alte Geschichte zuende erzählt bekommen. Der thematische Bogen in diesem Beitrag war vielleicht heute reichlich weit gefasst, aber irgendwie, finde ich, passte es dann doch wieder ganz gut zusammen.