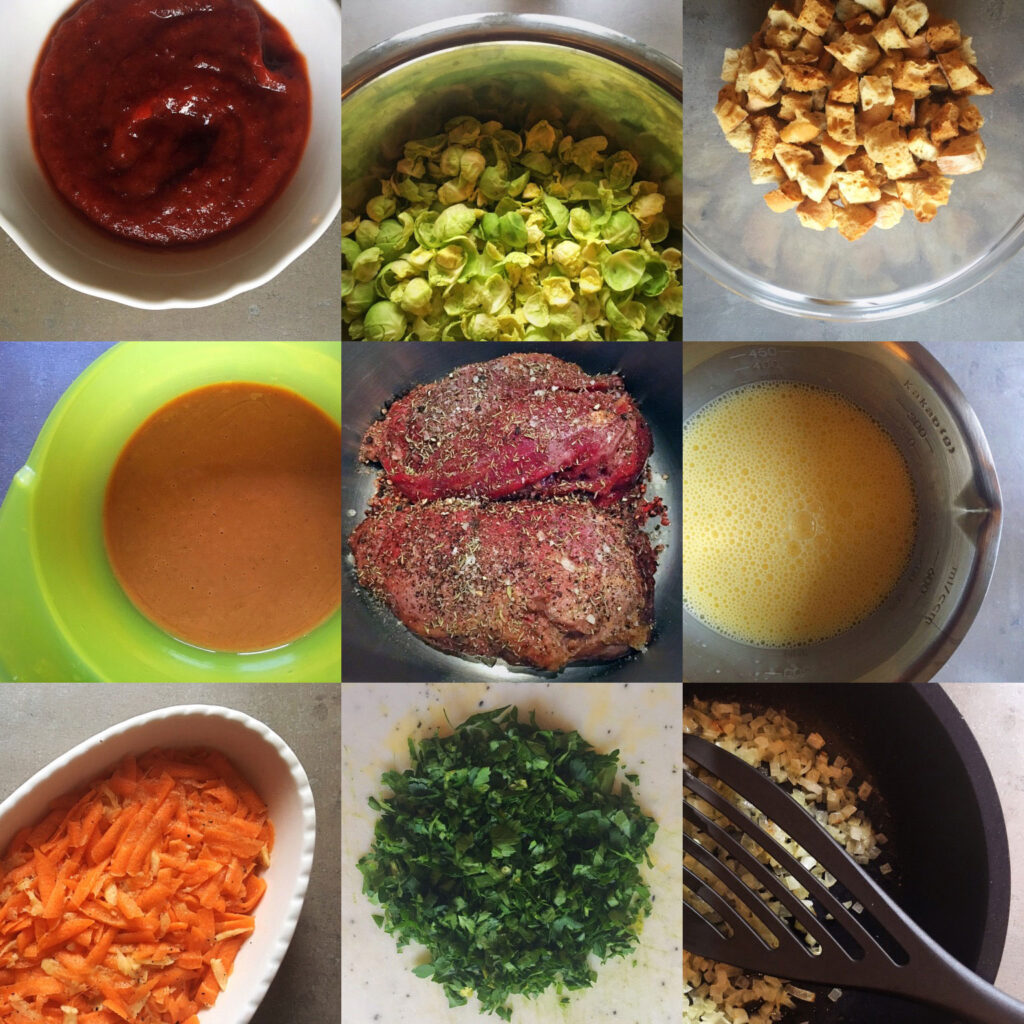▾ Springe direkt zum Focaccia-Rezept
Es gibt eine »Rubrik« in meinen Alltagserlebnissen, für die ich immer noch nach einem passenden Wort suche: kleine sensorische Überraschungen, die beim beiläufigen Kontakt mit vermeintlich banalen Alltagsgegenständen oder Nahrungsmitteln plötzliche, freudige Aufmerksamkeit wecken. Wenn ich zum Beispiel ein Hotelzimmer beziehe, das Bad zwecks Händewaschroutine aufsuche und beim Abtrocknen plötzlich denke »Wow, sind die Handtücher schön weich!«. Oder wenn ich in einer fremden Wohnung zu Gast bin und dort ebenfalls beim Händewaschen meine Nase aufmerkt »Oh, diese Seife riecht aber gut!«. Auch besonders hautschmeichelnde Bettwäsche, ein ungewöhnlich komfortables Sitzmöbel oder ein Gebrauchsgegenstand mit herausragend ergonomischem Design können bei mir erfreute Verblüffung dieser Art auslösen.
Am häufigsten passierte mir dies bislang in Restaurants. Das übliche Ritual ist es ja, den Platz einzunehmen, in die Karte zu schauen, eine schöne Speisenfolge sowie Getränke auszuwählen und dann bei leichter Konversation auf das Essen zu warten. Meistens wird während der Wartezeit vom Service ein Körbchen mit Brot o.ä. serviert, manchmal gibt es auch ein oder mehrere kleine Schälchen mit Aufstrichen: aufgeschlagene Salzbutter, Kräuterquark, Schmalz, ein Näpfchen mit Olivenöl oder dergleichen. Normalerweise mümmele ich das Brot entweder fast gleichgültig während des Tischgesprächs weg oder – wenn es bereits optisch und haptisch eher an Standardware erinnert – rühre ich es auch gar nicht erst an oder höre nach der ersten Scheibe damit auf, um mehr Platz für das folgende (meist bessere) Essen zu lassen.
Manchmal jedoch passiert es, dass die Unterhaltung plötzlich stockt, weil das Vorweggebäck alle Aufmerksamkeit abzieht, quasi die oben erwähnte Spontanekstase in Form bemerkenswerten Brotgenusses. Es kann ein besonders kerniges Brot sein, wunderbar duftend, unglaublich fluffig und dabei saftig, mit einer besonderen Gewürznote oder einfach eindeutig »selbstgebacken« schmecken. Dann ist das Körbchen ruckzuck leergefuttert und wird manchmal sogar nachbestellt. Oft frage ich das Personal auch, woher das Brot stammt und habe so schon etliche Male famose kulinarische Impulse bekommen oder neue Bezugsquellen entdeckt. So erfuhr ich bei meinem Besuch im Berliner Sternerestaurant »Reinstoff« (inzwischen leider geschlossen), dass das dortige Brot von der Hannoveraner Handwerksbäckerei »Broterbe Gaues« geliefert wurde, die kurz darauf mehrere Filialen in meiner Wohnstadt Hamburg eröffnete – seither bin ich regelmäßig Kunde dort (inzwischen heißt die Kette »Backgeschwister«, die Brote und ihre Qualität sind jedoch geblieben) und mein Lieblingsbrot ist das »Walnuss-Ciabatta«. Im Hamburger Restaurant »Die Bank« (inzwischen leider geschlossen) wurde vor dem Essen ein vortreffliches hausgebackenes dunkles Kaffee-Kardamom-Brot serviert, von dem ich netterweise einen Laib »to go« kaufen durfte und das ich auch schon einmal versucht habe, nachzubacken (ich kam recht dicht dran, aber das Original war besser). Es gab noch mehrere dieser unerwarteten Gaumenglücksmomente: in Berlin, in Prag – und im April 2022 in Hamburg im Restaurant »Kleine Brunnenstraße № 1«. Auch dort stellte der Kellner ein Körbchen hellen Brotes auf den Tisch – und schon beim ersten Biss war alle Achtsamkeit bei den Geschmacksknospen. Es war eine hausgebackene Foccacia, noch ofenwarm, außen mit einer rustikalen, aber dünnen Kruste, innen weich und feinporig, saftig und mit fantastischem Weizenaroma, gekrönt vom Geschmack frischer Rosmarinnadeln und zarter Salzflocken auf der Außenseite. Doch ihre bewährten und beliebten Rezepte rücken Restaurants ja leider selten heraus, und so fragte ich kurz danach in meiner Twitter-Bubble nach erprobten und geliebten Rezepten für Foccacia, denn so ein grandioses Backwerk wollte ich zu Hause auch mal zubereiten.
Die recht zahlreichen Antworten (siehe Thread zum obigen Tweet) lieferten viele gute Hinweise und Rezepte, zusätzlich ging ich auch noch einmal ins Netz und tauchte buchstäblich in den Focaccia-Kaninchenbau ein: Es gibt unzählige Rezepte und Rezeptvarianten, viele Berufs- und Hobbybäcker, Backfreaks und Foodblogger haben seitenweise Recherchen, Erkenntnisse, Tipps und Empfehlungen veröffentlicht. Es wurden Rezepturen renommierter Kochbuchautoren miteinander verglichen, eigene Verfeinerungen ausgearbeitet, es gibt gelingsichere und besonders schnelle Rezepte, welche, bei denen mehrere Mehlsorten gemischt werden oder solche, bei denen statt Hefe Sauerteig zum Einsatz kommt, was allerdings die Vorbereitungszeit auf mehr als einen Tag ausweitet, sofern man Muße, Lust und Zeit dafür hat.
Außer einigen Recherchen hatte ich jedoch seit April noch keinen eigenen Backversuch gestartet, teils war das Vorhaben aus dem Gedächtnis verdrängt, teils ergab sich keine passende Gelegenheit, denn ein solches Beilagenbrot braucht ja auch eine Grundlage, zu der es Beilage sein soll. Und wenn die heimische Menüplanung doch mal etwas Passendes enthielt, reichten entweder die verfügbare Zeit oder die verfügbaren Vorräte nicht, um noch »spontan« Focaccia zu backen. Doch dann hob Twitter das Thema wieder auf die Tagesordnung, mit einem Post von Frau @novemberregen, die nach Rezepten dafür fragte. Ich erinnerte mich an meine damaligen Twitter-Replys und reichte eine Rezeptempfehlung von @dammiLoh weiter.
Und plötzlich war die Lust am Nachbacken wieder erwacht, zumal für den gestrigen Abend eine Auswahl feiner Fischsalate vom Hamburger Isemarkt auf dem Speiseplan stand, wozu eine Focaccia die perfekte Beilage wäre. Also kaufte ich flugs ein und bereitete das empfohlene Rezept nahezu textgetreu zu (ich habe es hier ins Deutsche übersetzt und meine minimalen Änderungen integriert):
Alessandras Focaccia mit Rosmarin
Zutaten:
500 g Mehl (Type 405 oder 550)
1 Päckchen Trockenhefe
300 ml lauwarmes Wasser
50 g gutes Olivenöl + 6 EL für die Backform
10 g Zucker
10 g Salz
1–2 EL Rosmarinnadeln, vorzugsweise frisch (grob gehackt oder ganz)
1-2 TL Salzflocken
Zubereitung:
Direkt in der Rührschüssel die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen. Dann Salz, Zucker, Olivenöl und Mehl hinzufügen. Nun den Teig bei mittlerer Geschwindigkeit (mit Küchenmaschine oder Handmixer) mit Knethaken etwa 8 Minuten lang kneten. Wenn der Teig mit der Hand geknetet wird, am besten noch etwas länger. Den Teig kneten, bis er homogen wird. Er bleibt ziemlich klebrig, aber das ist wohl beabsichtigt.
Dann den Teig direkt in der Rührschüssel abgedeckt (z.B. mit einer Topfhaube oder einem Geschirrtuch) etwa eineinhalb Stunden gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.
Eine hohe metallene Backform (ca. 34 x 24 cm) oder ein tiefes Backblech gut einfetten mit mindestens 6 EL Olivenöl. Den Teig aus der Schüssel in die geölte Form geben und mit den Fingern rechteckig flachdrücken, bis er den kompletten Boden der Form ausfüllt. Darauf achten, dass am Rand ein Teil des Öls vom Boden der Pfanne auf die Oberseite des Teigs gelangt. Das nach oben gelangte Öl zum Schluss auf der Teigoberfläche gleichmäßig verstreichen.
Den Teig erneut abdecken und weitere anderthalb Stunden ruhen lassen.
Jetzt ist der Teig aufgegangen und bereit zum Backen. Die Abdeckung von der Backform entfernen, mit den Fingern über die Fläche verteilt einige Vertiefungen hineindrücken und nach Belieben nochmals mit etwas Olivenöl besprenkeln. Zum Schluss gleichmäßig mit Rosmarinnadeln und Salzflocken bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen (220 °C Ober-/Unterhitze oder 200 °C Umluft) etwa 14 Minuten backen (oder bis die Focaccia auf der Oberfläche goldbraun ist).


Fürs erste Mal war das Ergebnis ziemlich gut gelungen. Der Gier halber wurde das Gebäck noch warm in schmale, abbeißbare Streifen geschnitten und zum Fischsalatbuffet gereicht, wozu es hervorragend passte. Dennoch würde ich beim nächsten Mal (dieselbe Rezeptgrundlage vorausgesetzt) ein paar Details variieren.
Dadurch, dass die Facaccia in der Backform gebacken wurde, war sie zwar auf der Oberseite wunderbar knusprig, aber die Unterseite war für meinen Geschmack ein bisschen zu weich geblieben. Ich würde sie also entweder nächstes Mal am Ende der Backzeit aus der Form nehmen, im noch heißen, aber schon ausgeschalteten Ofen auf Backpapier noch 5 Minuten weiterknuspern lassen und schauen, ob dies das Ergebnis verbessert. Alternativ könnte ich auch nach Backvarianten suchen, bei denen die Focaccia ohne Form frei auf einem Pizzastein oder auf einem Blech (mit Backpapier?) gebacken wird, was vermutlich einen weniger üppigen Einsatz des Olivenöls mit sich brächte, aber dafür sorgen könnte, dass sie rundum etwas krosser würde.
Zweitens war mir der Teig mit der gewählten Mehlsorte »Kuchenmehl« (Typ 405 der im Supermarkt gekauften Marke »Diamant«) ein wenig zu fein und zu kultiviert, ich vermisste die rustikale, erdige Robustheit bei Teig und Kruste der im Restaurant genossenen Vorlage. Bei einem erneuten Versuch würde ich daher wohl den etwas kräftigeren Weizenmehltyp 550 ausprobieren und zudem ein wirklich gutes Biomehl oder sogar eins von einem Hofladen oder einer Handwerksmühle besorgen, denn auch der spürbare Weizen-/ Getreidegeschmack war im Debütgebäck noch lange nicht so intensiv wie in meiner Erinnerung.
Ansonsten ein tolles, schnell durchführbares und gutes Rezept, auf dem sich aufbauen lässt. Meinen ersten Versuch habe ich zunächst bewusst – außer Flockensalz und Rosmarin – nicht mit weiteren Belägen wie Tomaten, Zwiebeln usw. zubereitet, um die Teigbeschaffenheit und das Grundaroma möglichst »pur« bewerten zu können. Sowie das einmal perfektioniert ist, kann ich mir aber durchaus auch üppiger belegte Varianten vorstellen. Oder ich springe nochmal ins »Rabbit Hole« und probiere weitere Rezeptversionen aus.
Es war jedenfalls nicht mein letzter Versuch.