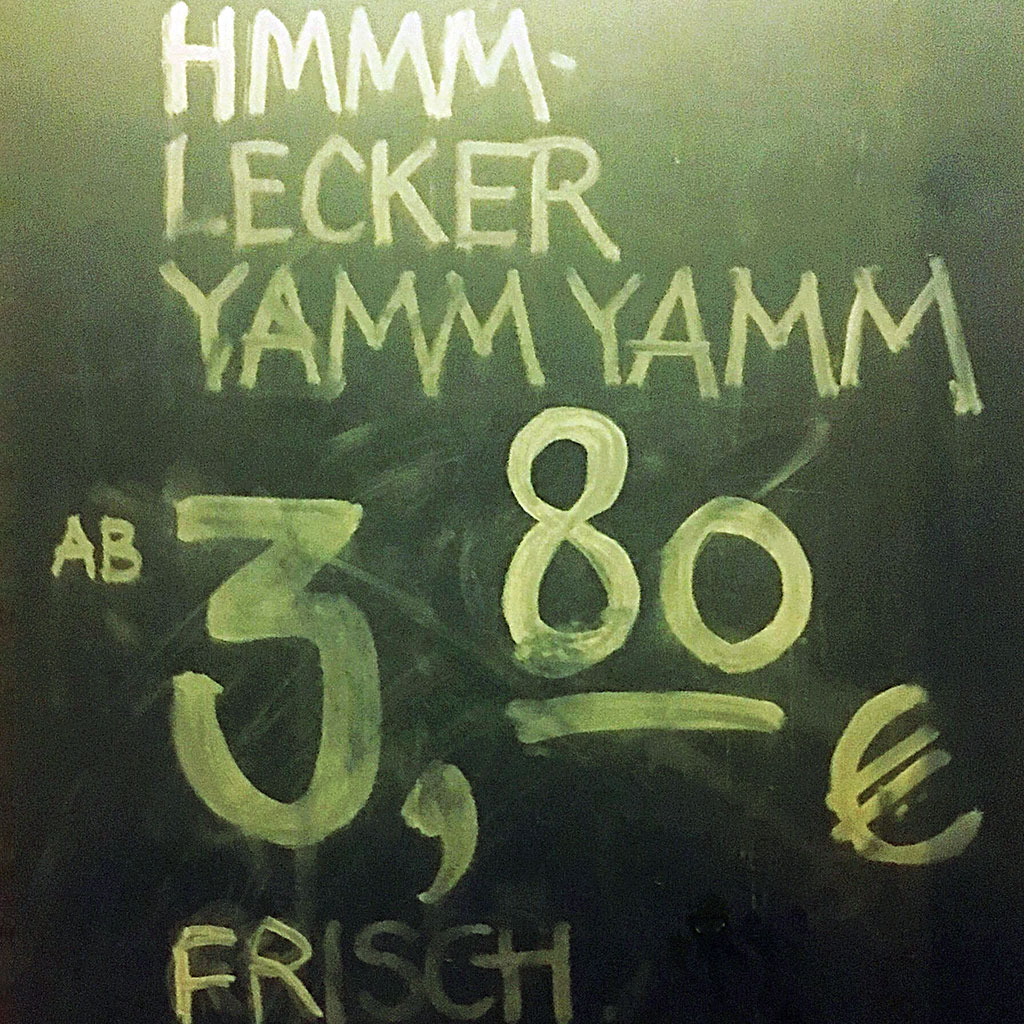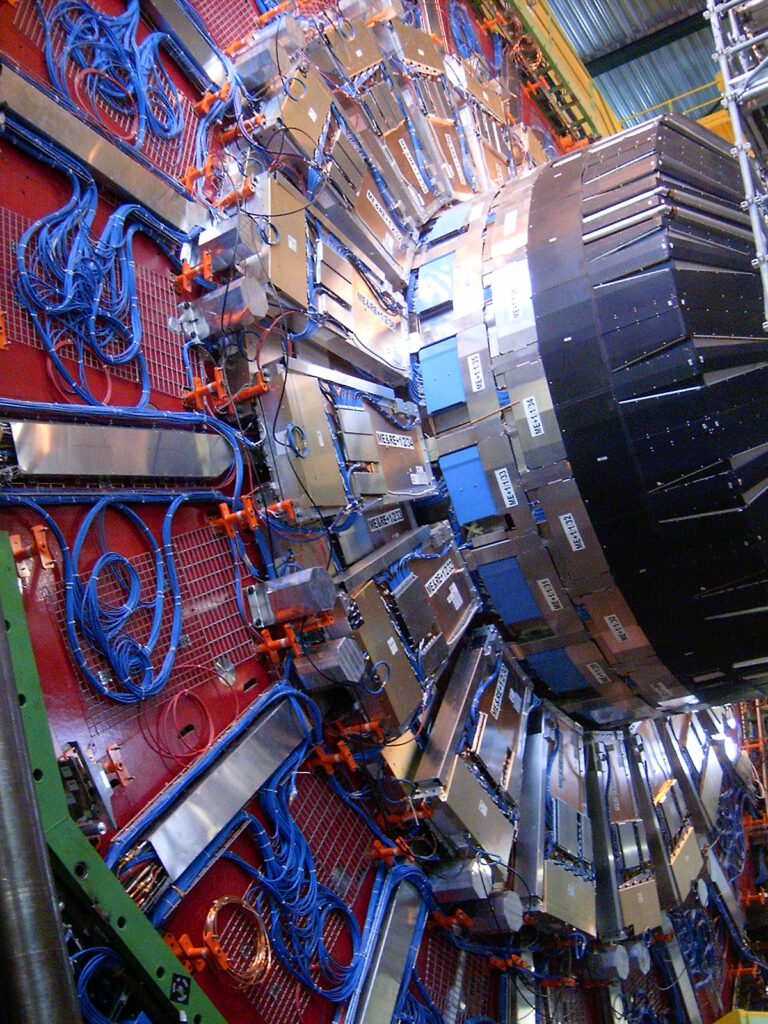Gestern erschien in meiner Facebook-Chronik ein schöner Beitrag der Cartoonistin Bettina Schipping (nur sichtbar für verbundene FB-Freunde) mit dem Titel »Mutters Duft«. Er war ein bisschen geschrieben wie ein Blogartikel und erzählte sehr anschaulich von der besonderen Verbindung, die die Autorin von Jugendtagen an mit dem Parfum »Coco« von Chanel hatte und wie dieser Duft, eher unbeabsichtigt, zu »ihrem« Duft wurde. Diesen Bericht habe ich gerne gelesen und er stieß in mir Gedanken an, welche Gerüche, Düfte, Parfums für mich so prägend waren, dass ich mich bis heute daran erinnern kann oder ganz bestimmte Orte, Personen oder Situationen eindeutig damit verbinde.
Die frühesten Gerüche, an die ich mich erinnern kann, haben wenig mit Parfum zu tun. Ein Geruch, der zwar etwas speziell ist, den ich aber nie als unangenehm empfand, war der Geruch in den Räumen der Fleischerei meiner Großeltern mütterlicherseits. Hier war ich als Kind schon von Geburt an mit den Eltern regelmäßig zu Besuch und ich muss etwa 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein, als ich dieses Aroma bewusst wahrnahm und in meinem Geruchsgedächtnis abspeicherte: es ist ein Gemisch aus sehr frischem, rohem Fleischgeruch (sicherlich auch tierisches Blut), etwas metallisch, dem Duft verschiedener Gewürze und gewerblichen Reinigungsmitteln. Viele Fleischereien riechen sehr ähnlich, auch aus dem Abluftgitter der Fleischerei »an der Ecke« nahe meiner Wohnadresse in Hamburg weht dieser Geruch ab und zu auf den Gehsteig und ich muss dann sofort an Omas und Opas Laden denken.
Der zweite frühesterinnerte Geruch ist wesentlich unangenehmer. Schon als Kleinkind litt ich häufig, und wohl öfter als üblich, an vereiterten, entzündeten Mandeln, so dass der damalige Kinderarzt dazu riet, die allzuoft kränkelnden Organe »rauszunehmen«. So kam es, dass ich – ebenfalls ungefähr mit 4 oder 5 Jahren – dazu meinen ersten Krankenhausaufenthalt erlebte. Die Anästhesie damals, es war Anfang der 1970er Jahre, wurde in der betreffenden Klinik noch mit Äther vorgenommen und der unangenehme medizinisch-süßliche Geruch, welcher der Gummimaske entströmte, die mir vor dem Eingriff aufs Gesicht gedrückt wurde, hat sich sehr nachhaltig in mein Geruchsgedächtnis eingeprägt. Glücklicherweise ist er im Alltag kaum irgendwo sonst anzutreffen, so dass mir Flashbacks an diesen Eindruck seither weitestgehend erspart blieben.
Schwieriger an einem konkreten Kindheitsalter festzumachen sind meine Erinnerungen an »echte« Düfte von Parfums oder Kosmetikartikeln, aber es müssten ebenfalls die 1970er Jahre gewesen sein, in denen ich ihnen begegnete. Mein Vater nutzte nach der Gesichtspflege lange Zeit ein Rasierwasser namens »Tabac Original«, einen Duft, der seit 1959 und bis heute erhältlich ist. Ob die Rezeptur und der Duft immer noch dieselben sind, kann ich nicht sagen, vielleicht sollte ich mal in einem Geschäft eine Geruchsprobe vornehmen und prüfen, ob auch dieses Bouquet mich zurück in meine Kindheit versetzt. An ein bestimmtes Parfum meiner Mutter aus dieser Zeit kann ich mich nicht erinnern, wohl aber an den Geruch ihrer bevorzugten Haarspraymarke »Elnett«, auch dieses Produkt ist bis heute in fast unverändertem Design erhältlich. Wie die illustrierte Dame auf der Spraydose pflegte auch meine Mutter damals ihr Haar zu »toupieren«, ehe sie ihre fertige Frisur mit dem Aerosol aus der Dose fixierte. Eine weitere Erinnerung habe ich an den Duft zweier Pflegeprodukte, die damals oft in unserem Badezimmer standen: Das eine war das populäre »Schauma«-Shampoo mit der damals eine zeitlang sehr beliebten Duftnote »grüner Apfel«, das andere war ein Schaumbad, dessen Marke bzw. Name ich nicht mehr erinnere (es war, glaube ich, irgendwas mit »S« am Anfang) [Update: ich habe es tatsächlich im Netz wiedergefunden, der Badezusatz hieß »Sopree«!] und mit dessen karamellfarbener Kunststoffflasche ich undeutlich die Illustration einiger Blütenkelche verbinde. Die Duftnote nannte sich »Sandelholz« und auch diesen Duft habe ich bis heute in der Nase. Wenn ich erkältet war, rieb mir meine Mutter die Brust mit »Wick VapoRub« ein und auch dieses zu Tränen reizende und dennoch nicht abstoßende kampferartige Aroma ist bis heute fest in meinem Duftspeicher verankert.
Bei den Omas standen damals im Schlafzimmer und Badezimmer oft Flakons der Kaufhausduftwässer »Nonchalance«, »Tosca« und »4711«, letzteres kann ich noch einigermaßen memorieren, wie die ersten beiden rochen, leider nicht. Dafür habe ich noch den Duft von »Fenjala« in der Nase, das es bei der Oma väterlicherseits ebenfalls als Badezusatz gab und das dann eben mangels altersgerechter Alternativen auch für meine Kindervollbäder zur Anwednung kam (manchmal war es tatsächlich ein Kinderschaumbad namens »Plantschi« vorrätig, aber hier sehe ich heute nur noch – ohne jegliche Dufterinnerung – dessen typische gelbe Plastikflasche vor meinem geistigen Auge). Die andere Oma hatte neben einem Schaumbad in der Duftrichtung »Latschenkiefer« auch stets eine medizinische Salbe in Anwendung, deren Geruch ich damals als sehr angenehm empfand und sie mir deshalb ab und zu dünn auf die Hände auftrug. Die Salbe war hellbraun und halbdurchsichtig (vermutlich eine Rezeptur auf Basis von Wachs oder Vaseline) und hatte einen Duft, der stark an Vanille erinnerte. Ich erinnere mich auch noch an die Farbgebung der flachen kreisrunden Blechdose, in der die Salbe verpackt war. In der Aufsicht war sie halb weiß, halb »himbeerrot«, den Namen des Produkts erinnere ich allerdings nicht mehr (Update: Per Kommentar erhielt ich den netten Hinweis auf den Namen der Salbe, sie hieß PERU-LENICET und ist bis heute erhältlich). Jene Oma wohnte damals aus Altersgründen im Haushalt von Onkel (Mutters Bruder) und Tante und auch hier waren wir mit der Familie häufig zu Besuch. Unter der Treppe, die zu Omas Wohnbereich im ersten Stock führte, gab es ein winziges, nie geheiztes Gästeklo. Die Klobrille war insbesondere im Winter eisig kalt, das brotscheibenwinzige Handwaschbecken hatte nur einen Kaltwasserhahn und die Dufterinnerungen, die ich fest mit dieser frostigen Kammer verbinde, waren die Gerüche der »Lukiluft«-Raumsprays, die dort bereitstanden. Meist war es die Sorte »Flieder«, aber auch »Zitrone« fand sich ab und zu auf der Fensterbank.
Natürlich hatten auch die Wohnräume von Onkeln, Tanten, Omas und Opas ihren ganz eigenen Geruch, der aber so unspezifisch war, dass ich ihn nicht beschreiben könnte. Nur manche »Ecken« stachen in ihrer Aromatik so charakteristisch hervor, dass sie erinnerbar und beschreibbar sind. Bei den Großeltern väterlicherseits war dies zum einen das Arbeitszimmer des Opas, das nach Holz und Möbelpolitur, betagten Sitzpolstern, altem Papier aus dem Bücherschrank und einem eigentümlichen Hauch von Büromaterial roch (Stempelkissen? Farbbänder? Tinte?). Unter der Treppe im Hausflur führte eine dunkle, verwinkelte Steintreppe hinab in den Heizungskeller, und sowie die Spanplattentür zu diesem Kellerabgang aufschwang, wurde man von einer Wolke aus Heizölgeruch und leicht feuchtem »Kellermuff« umweht, deren Geruch ich gleichfalls bis heute nicht vergessen habe. Hinten im Vorratskeller, dessen Rückwand direkt an den felsigen Berghang hinter dem Haus grenzte, roch es nach Eingemachtem, nach Kartoffeln, Äpfeln, Staub und feuchtem Gestein und da ich mich während der Ferien bei dieser Oma schon als Kind ungehindert aus ihren Vorräten bedienen durfte, um meine ersten improvisierten Koch- und Backversuche zusammenzurühren, habe ich auch den Geruch nach Mehl, Gewürzen, trockenen Kräutern und anderen trockenen Zutaten aus ihrem Küchenschrank bis heute in der Nase, ebenso den Duft aus ihrer Waschküche, wenn die Kochwäsche in der alten Waschmaschine rotierte. Abends deckte mich die Oma in ihrem kleinen Gästezimmer mit einem monströs voluminösen Federbett zu, das mit duftiger reinweißer Bettwäsche bezogen war und dessen Geruch ich bis heute nirgendwo anders je wieder wahrnahm.
A propos »Opas alte Bücher«: einer der gespeicherten Gerüche aus früher Kindheit war ebenfalls in einem Bücherschrank zu Hause. Von meiner Mutter hatte ich ein schon reichlich zerlesenes und vergilbtes Buch mit den klassischen Märchen der Gebrüder Grimm geerbt. Der arg lädierte Papp-Umschlag war mit »d-c-fix«-Klebefolie umhüllt und so einigermaßen haltbar restauriert worden, leider war dadurch das Original-Cover nicht mehr sichtbar. Das Buch, es muss Ende der 1930er Jahre erschienen sein, war tatsächlich noch in Frakturschrift gesetzt und mit zahlreichen Aquarellen der Illustratorin Ruth Koser Michaels bebildert (die Illustration zum Märchen »Gevatter Tod« stand mir noch eindrücklich vor Augen). An die Märchen erinnere ich mich noch gut, es waren die ursprünglichen Versionen mit oftmals sehr grausamen Enden – die »bösen« Protagonist*innen mussten in glühenden Schuhen tanzen, verstümmelten sich die Füße (»Ruckediguh, Blut ist im Schuh«) oder wurden in mit Nägeln gespickten Fässern zur Strafe Hügel hinuntergerollt. Angst bereitete mir das interessanterweise nicht, ich nahm es mit dem Gleichmut des die Welt der Bücher erkundenden Kindes hin. Dieses Märchenbuch hatte ebenfalls einen ganz eigenen Geruch. Das alte, bräunlich gealterte Papier verströmte einen geheimnisvollen, leicht muffig-staubigen Geruch, dem ich danach auch bei anderen alten Büchern oder in antiquarischen Buchhandlungen wieder begegnete.
Der ältere Bruder meines Vaters war damals schon sowohl Lehrer als auch Schulleiter und wohnte im selben Dorf wie die Großeltern. Das war praktisch, denn so konnte ich dank seiner Zugangsmöglichkeit in den Ferien immer mal wieder durch das ansonsten menschenleere Schulgebäude stromern und mich zudem mit Büchern aus der Schulbibliothek für meine Ferienlektüre eindecken. Und so gehört auch der ganz eigene Duft der verlassenen Schule nach Linoleum, Bohnerwachs, Kreide und Bastelmaterial zu meinen Kindheitserinnerungen. Aus meiner Schulzeit abseits der Ferien habe ich noch den scheußlichen Geruch des mit altem Kreidewasser getränkten Tafelschwamm in der Nase und auch das säuerlich-muffige Odeur der Sport-Umkleide, von dem man unweigerlich im eigenen Turnbeutel ein Quentchen mit nach Hause nahm, hat sich bis heute dort festgesetzt. Riechen Schulen und Umkleiden heute immer noch so?
Neben den Gerüchen der Schul- und Klassenräume gab es aber auch allerlei Gerüche, die ich mit Spielzeugen und Werkstoffen verbinde, mit denen ich mich damals beschäftigte. Seit jeher hatte ich als Kind gerne »gebastelt« und kann mich heute noch an die Düfte diverser Klebstoffe erinnern, vom eher harmlosen Prittstift über den gelbschwarzen Alleskleber-Tubenklassiker UHU, den milchiggelben Pattex-Kleber bis hin zum seltsam marzipanähnlich duftenden, weiß-pastosen »Pelikanol«-Kleber, den man aus einer Alu-Schraubdose mit einem beigefügten Pinsel auf die Klebeflächen auftragen musste. Verschiedene Knetmassen hatten ihren ganz eigenen typischen Geruch, einerseits die leicht fettig anmutende »normale« Knete, andererseits der süßlichere Geruch der Markenknetmasse »Play Doh« oder das charakteristische Aroma der aus »Fimo« gekneteten und anschließend im heimischen Backofen dauerhaft gehärteten Werkstücke. Ebenfalls dem Backofen entströmte der Plastikgeruch des Bastelgranulats »Schmelzolan«, das zu bunten Scheiben verschmolzen und, mit Schnüren zu Girlanden oder Mobiles kombiniert, etliche Fenster damaliger Familienhaushalte zierte. Der Geruch des ersten Chemie-Experimentierkastens. Eine neu gekaufte Schlumpffigur. Frisch angespitzte Buntstifte oder Bleistifte. Das Deckweiß und die Farbnäpfe aus dem »Pelikan«-Schulmalkasten. Edding-Marker. Plakafarbe. Wachsmalstifte. Radiergummis. In den mit Spiel und Kreativität verbrachten Stunden liegt ebenfalls ein ganzer Kosmos eigener Geruchserinnerungen.
Aus dem elterlichen Zuhause sind bei mir ansonsten nur noch einige spezifische Essensgerüche haftengeblieben, die mich begrüßten, wenn ich aus der Schule heimkam und die Mutter (ehe sie später wieder berufstätig war) das Mittagessen zubereitet hatte. So war auf Anhieb klar, wenn es Fischstäbchen, Eierpfannkuchen, Bohnensuppe (mit Bohnenkraut) oder Kartoffelpuffer gab, oder wenn sie ab und zu einen Rührkuchen buk.
Ich glaube, viele Gerüche und Düfte meiner Jugend gehören bei vielen Kindern – zumindest denen aus meiner Generation – zu einer Art »kollektivem Erinnerungsschatz«. Im Sommer war das der Geruch von Sonnenmilch und Chlor- oder Salzwasser, vielleicht dazu Pommes vom Freibadkiosk, im Winter der Duft von heißem Kakao, wenn man nach stundenlangem Rodeln aus dem Schnee wieder heimkam. Die Gerüche beliebter damaliger Süßigkeiten, etwa After Eight, Wrigley Spearmint, Hubba Bubba, Schaumzucker-Erdbeeren, flüssig gefüllte Erfrischungsstäbchen, Butterkekse, Lakritzschnecken oder Kirschlollis. Der Geruch von klarem Zitronensprudel (nicht Sprite!), von »Caro Kaffee« oder Malzbier. Lenor-Weichspüler, Odol Mundwasser, Bügel-Sprühstärke. Es war der Geruch der 1970er und frühen 1980er Jahre.
Einige Jahre später musste ich, begleitend zu meinem Studium der »Kommunikationsgestaltung« insgesamt sechs Monate gestalterische Praktika vorweisen, die ich wahlweise auch auf mehrere verschiedene Betriebe aufteilen durfte. Und auch aus dieser Zeit sind Düfte und Gerüche in meinem Gedächtnis hängengeblieben. Aus der vierwöchigen Tätigkeit in einer Siebdruckerei nahm ich die Aromen von PVC-Folien, Druckfarben und Lösungsmitteln mit. Die Chefin einer kleinen Werbagentur, wo ich drei weitere Monate verbrachte, sprühte sich vor Kundenterminen regelmäßig mit »Fendi Donna« ein, ein Parfum, dessen schwarzpfeffrige Note ich als sehr angenehm empfand. Und aus der zweiten Agentur, die mich aufnahm, blieb mir vor allem der Geruch des Sprühklebers in Erinnerung, mit dem ich in einem eigens abgetrennten Verschlag regelmäßig die großen Blätter mit Skizzen, Entwürfen und Layouts auf Präsentationspappen aufkaschieren musste.
Für »richtige« Parfums begann ich mich selbst erst zu interessieren, als ich selbst genug Geld verdiente, um mir die vergleichsweise teuren Duftkreationen leisten zu können. Ich glaube, mein erstes eigenes Parfum als früher »Twen« war »Fahrenheit« von Dior, ein bis heute sehr präsenter Duft in meiner olfaktorischen Gedächtnisbibliothek. Es folgten der Klassiker »Cool Water« von Davidoff und »Nightflight« von Joop!, ein Duft, nach dessen Aufsprühen ich stets sofort mehrfach niesen musste. Im Badezimmer meiner ersten eigenen Wohnung reservierte ich eigens ein gläsernes Regal für die angeschafften Flakons, deren Bestand sich bald zu einer regelrechten Sammlung ausweitete. »Tommy« von Hilfiger, die frischwindigen Düfte »L’Eau D’Issey« und »L’Eau par Kenzo«, das würzige »Fendi Uomo«, »Acqua di Giò« von Armani, der Unisexduft »cK One«, das veilchenlakritzige »Ègoïste« und später das elegante »Allure« von Chanel, der Feldflaschenflakon des BOSS-Duftes »Hugo« und etliche andere. Und auch hier gehen die Dufterinnerungen über die reine Wahrnehmung der Kopf-, Herz- und Basisnoten hinaus. Mit »Background« von Jil Sander verbinde ich einen sehr romantischen One-Night-Stand und auch das holzige Aroma von »BOSS« ist für mich eng und durchaus positiv verknüpft mit einer Art »Affäre«, die zwar etwas länger währte, aber dann irgendwann genauso verflog wie der Duft.
Mit der Zeit änderten sich meine Gewohnheiten bezüglich kosmetischer Düfte und ich könnte nicht einmal genau sagen, woran das lag. Das Interesse an komplexen, eigens komponierten Eaux de Toilette ließ nach, inzwischen verwende ich sie eigentlich nur noch, wenn besondere Anlässe, Veranstaltungen oder Feierlichkeiten anstehen. Stattdessen wuchs seither in meinem Badezimmer die Sammlung an Duschgel-Varianten, die zumeist nur dezent nach einer einzigen oder sehr wenigen, eindeutig identifizierbaren aromatischen Ingredienz duften. Vorrätig sind derzeit u.a. Zimt, Thymian-Rosmarin, schwarzer Pfeffer, Kokos, Hanf, Kaffeebohnen, Schokolade, Maiglöckchen, Honig, Kiefer, Minze, Birkenteer (riecht wie Lagerfeuer!) oder Bergheu. Davon bleibt nach dem Duschen, in Kombination mit einem unparfümierten Deodorant, genug Duft übrig, um hinreichend frisch durch den Tag zu kommen. Gefördert wurde diese Vorliebe zu mehr Dezenz sicherlich auch durch die mit Maske durchlebte Zeit in der Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie. Nie zuvor empfand ich viele Menschen als so übermäßig von Duftwässern unterschiedlichster Preiskategorien durchtränkt wie direkt nach der Rückkehr zu einem weitestgehend maskenlosen Alltag. Offenbar hatte die Nasenisolation unter dem FFP2-Filter die Empfindlichkeit der Riechzellen gesteigert und das wohl auch bezogen auf die eigene Fremdduftintensität.
Vielleicht hat meine so entstandene Vorliebe für »singuläre« Düfte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich den Duft fast aller Küchenkräuter so sehr mag. Ob Lorbeer, Korianderkörner, Zimt, Ingwer oder Basilikum – seit mittlerweile Jahrzehnten hege und pflanze ich in den Blumenkästen auf meinem Balkon hauptsächlich Kräuterpflanzen an, die ich in der Küche verwenden kann. Aber bei jedem Gießen, Eintopfen, Pflegen oder Ernten gehört es für mich auch dazu, vorsichtig an einigen Blättchen zu reiben und diese herrlichen Düfte von den Fingerspitzen zu inhalieren. Und ich merke, da ich dies schreibe, dass die für mich bedeutsamen Aspekte des Themas »Kräuter, Gewürze und Aromen in der Küche« schon wieder genug Gedanken für einen eigenen Blogartikel wecken. Malkukken.
(Zum Schluss wie immer die freundliche Einladung, gerne eigene Kommentare, Gedanken, Erinnerungen an Düfte und Gerüche hier oder auf Mastodon zu hinterlassen. Mich würde sehr interessieren, wie weit zurückreichend, dominant oder lebendig Euer Duftgedächtnis ist.)
Edit: Seit ich den Artikel veröffentlicht habe, fallen mir ständig noch weitere Düfte und Gerüche ein, die ich mit speziellen Momenten verbinde. Eher angenehm: Der Geruch, wenn man im Spätherbst zum ersten Mal die Heizung aufdreht und der Raum für einige Stunden nach dem erhitzten Staub riecht, der sich versteckt auf dem Heizkörper abgesetzt hat. Der Geruch, wenn es in einem heißen Sommer lange nicht geregnet hat und ein Platzregen endlich den staubigen Boden klatschnass durchfeuchtet hat. Der Geruch, wenn an einem kalten Wintertag ganz präsent »Schnee in der Luft liegt«, der dann auch kurz danach fällt. Frisch gemähter Rasen oder trockenes Heu. Der Duft beim Mandarinenschälen. Wie ein voller Staubsaugerbeutel riecht. Der Geruch aus einem Karton oder einer Truhe, z.B. auf dem Dachboden, mit lange darin aufbewahrten Kleidungsstücken oder Textilien. Die Rauchschwaden einer soeben verloschenen Kerze. Die Aromen von Zuckerwerk, Schmalzkuchen und Imbissgerichten, die auf einem Jahrmarkt durch die Menschenmenge wehen. Ein frisch angezündetes Streichholz. Nicht so schön: Volle Mülleimer im Hochsommer. Nasser Hund oder Hundekacke unterm Schuh. Übler Mundgeruch bei Gesprächskontakt auf kurze Distanz. Dunkle Beton-Unterführungen, die als Urinal missbraucht wurden. Es ist ein unendliches, ebenso berührendes wie abstoßendes, sinnliches Universum.