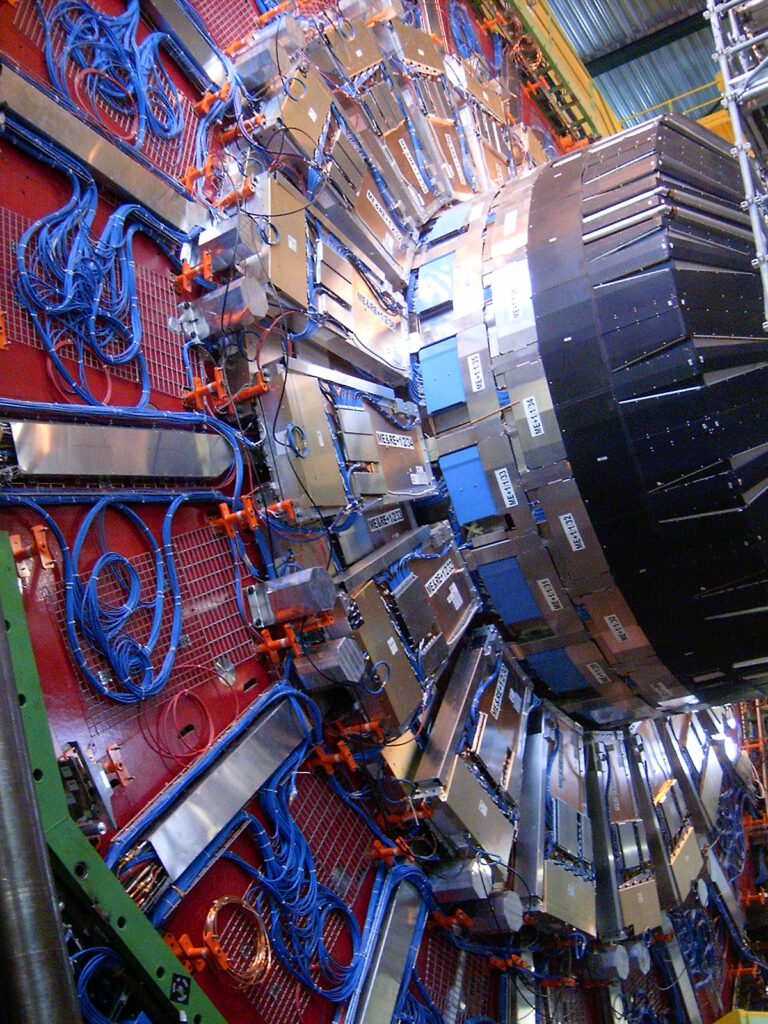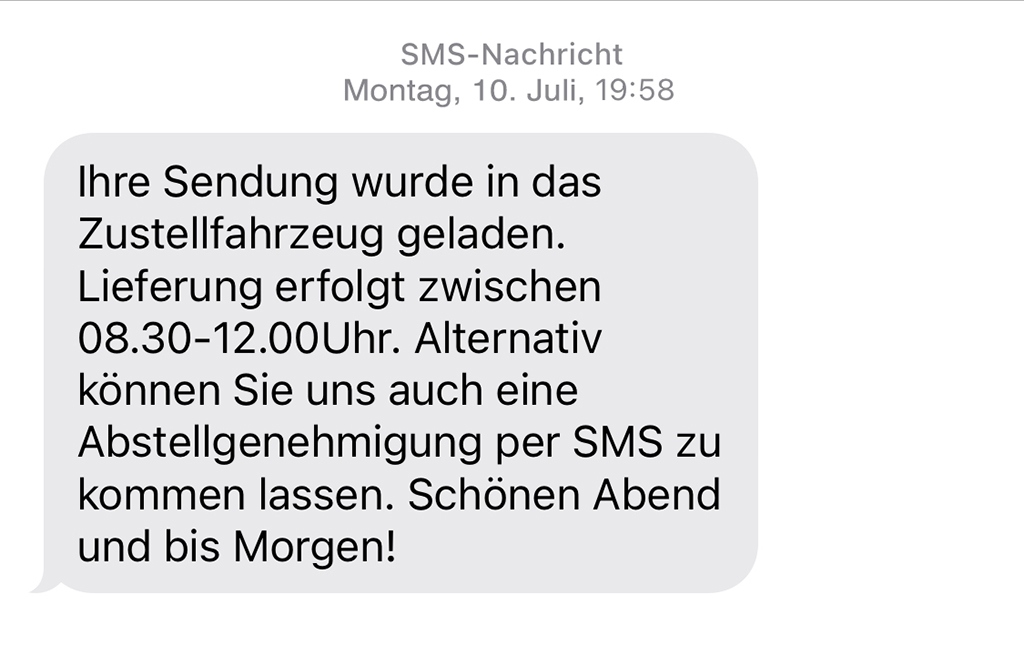Fast immer, wenn ich ungefähr alle vierzehn Tage fernbeziehungsbedingt freitags nach Berlin fahre, nehme ich ab Berlin Hauptbahnhof eine Verbindung zum U-Bahnhof Schlesisches Tor und treffe mich dann dort in der Nähe, pünktlich nach seinem Feierabend mit dem Mann im Craft-Beer-Pub »Hopfenreich«, um das Wochenende einzuläuten. Ich weiß nicht, wie oft ich den Weg vom »Schlesi« zum Pub schon gegangen war, als mir eines Tages am Wegesrand ein orientalisches Imbissrestaurant auffiel. Zuerst war es der Name, der an meine Wortspielrezeptoren andockte: »The Hummusapiens«. Dann las ich die Unterzeile »Beirut – Berlin · Levantine Street Food«. Und schließlich fiel mein Blick auf die hinterleuchtete große Speisekartentafel neben dem Eingang. »Mmmh!«, dachte ich, »Da müssen wir mal was »to go« bestellen!
Seit ich die aromatische Kichererbsenpaste kenne, bin ich Hummus-Jünger und habe mich auch schon ausgiebig mit der Herstellung dieser köstlichen veganen Spezialität in der eigenen Küche befasst. Mein persönliches, optimiertes Rezept steht inzwischen seit Jahren eigentlich unverändert fest. Manchmal kürze ich den Prozess etwas ab, indem ich fertig gekochte, konservierte Kichererbsen als Rohstoff nehme, manchmal nehme ich mir die Zeit und weiche geschälte halbe getrocknete Kichererbsen über Nacht ein und koche sie am nächsten Tag selbst. Der Aufwand bringt zwar geschmacklich nur einen überschaubaren Gewinn, aber die Cremigkeit des Endprodukts steigt durch die hüllenlose Trockenware deutlich.
Trotzdem waren es die mundwässernd klingenden Kombinationen auf der Menütafel des Imbiss, die mich über das Hummus hinaus neugierig machten. »Hummus, Harhana Sauce, sesame sauce, bread« gehören zu jedem der Gerichte standardmäßig dazu. Darüber hinaus werden neun Beilagenvarianten angeboten: Bulgur, Falafel, Makali (fritierte Kartoffeln und Auberginen), Hot Batata (marinierte fritierte Kartoffeln), Halloumi, Champignons, gebratenes Rinderhack mit Pinienkernen, Makani-Rinderwürstchen und gebratene Hähnchenleber. Also fünf Mal vegan, einmal vegetarisch und dreimal mit Fleisch. Eine schöne Auswahl. Nachdem ich dem Mann von der Entdeckung berichtet hatte, beschlossen wir an einem der folgenden Berlinwochenenden drei der Gerichte zum Mitnehmen auszuprobieren. Und es war köstlich! Alle Beilagen waren schön gebräunt gegrillt, fritiert oder scharf angebraten, das Hummus war cremig, sesamnussig und weder mit Knoblauch noch mit Zitrone überwürzt und die »Harhana Sauce« entpuppte sich als ein ziemlich scharfes, fein-aromatisches Korianderpesto. Es folgten etliche weitere Schlemmerabende mit verschiedenen Bestellungen und ich freue mich jedesmal wieder, dass es diesen Laden dort gibt.
Diese Woche nun, während ich in Hamburg weile und auch am Wochenende nicht in die Hauptstadt fahre, überkam mich ein großer Appetit nach dem Hummusapiens-Gericht »Hummus Makali« mit fritierten Auberginen. Doch Berlin ist weit. Also hieß es: Wer schlemmen will, muss findig sein! Wie könnte ich das ersehnte Gericht selbst zubereiten? Auf die Kartoffeln wollte ich des Aufwandes und der Kohlehydrate wegen verzichten. Was mich bei der Verkostung des Originalgerichts besonders begeistert hatte und was ich unbedingt auch hinbekommen wollte, waren die krosse Kruste und das cremige, nicht mit Öl vollgesogene Innere der Eierfrüchte. Ich erinnerte mich an zwei famose Tricks dazu aus einem YouTube-Rezeptivideo für das chinesische Auberginenrezept »Yu Xiang Qie Zi«: Zuerst werden die geschnittenen Auberginen für etwa 15 Minuten in Salzwasser eingelegt und anschließend fein mit Speisestärke bepudert, ehe sie in reichlich Öl gebraten werden. Das eingedrungene Wasser bildet eine Barriere im äußeren Fruchtfleisch der Auberginenstücke und mindert so das Eindringen des heißen Öls und die dünne Schicht Stärke sorgt im heißen Fett für eine schöne goldbraune Kruste. Ich beschloss, diesen chinesischen Kniff auf meinen Nachbau des orientalischen Gerichts zu übertragen.
Blieb noch die Frage, woraus die »Harhana Sauce« des Streetfoodladens bestand. Als ich danach googelte, erhielt ich ausschließlich Suchergebnisse, die auf das Hummusapiens zeigten und keine Angaben zu Zutaten oder Zubereitung enthüllten. Also handelte es sich wohl entweder um eine selbst kreierte Sauce mit geheimem Rezept oder um eine zu Marketingzwecken umbenannte regionale Zubereitung mir noch unbekannten Namens. Ich suchte gemäß meiner Analyse des Geschmacks des Dips daraufhin alternativ nach »spicy lebanese cilantro pesto« – und siehe da: es ploppten diverse Rezeptseiten auf für eine pestoähnliche Zubereitung namens »Zhoug« (andere Schreibweisen sind Schug, Skug, S-chug, Schugg, Skhug oder Zhug) aus hauptsächlich Koriandergrün, Knoblauch, (grünen) Chilischoten, Gewürzen und Olivenöl. Die Rezepte unterschieden sich zwar in Nuancen (mit/ohne Petersilie, mit/ohne Zitrone, mit/ohne Kümmel/ Kreuzkümmel/ Korianderkörner/ Pfeffer/ Kardamom), aber die grundsätzliche Beschreibung deckte sich mit meiner Geschmackserinnerung. Nachdem ich einige Rezepte durchgelesen hatte, entschied ich mich für eins, das angenehm raffiniert klang und ergänzte es um die Zutat Kardamom aus einer anderen Variante. Das Ergebnis kam ziemlich dicht an das Aroma der gekauften Sauce heran, im Nachhinein würde ich es nur noch ein wenig optimieren (höherer Anteil Koriandergrün und dafür weniger Petersilie, weniger Zitronensäure, etwas mehr Schärfe durch Chiliflocken). Dem Nachbau des Hummusgerichts stand somit nichts mehr im Weg. Bonus: es ist komplett vegan – und schmeckt vortrefflich!
Zutaten (für 2–3 Personen):
für das Hummus
Eine komplette Zubereitungsmenge Hummus nach meinem Rezept hier im Blog
für die Auberginen
2 Auberginen (ich hatte das Glück, im türkischen Gemüseladen eine sehr lange schlanke Sorte zu bekommen, die waren zum Schneiden und braten perfekt!)
1 EL Speisestärke
1 leicht gehäufter EL Salz
Wasser
Olivenöl zum Braten/Fritieren
für das Zhoug
1 Handvoll Petersilie
3 Handvoll Koriandergrün
1 grüne Chili (mittelscharf bis scharf)
2–3 TL Zitronensaft
ggf. abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone
1 gestr. TL Salz
3 kleine Knoblauchzehen
1 gestr. TL Chiliflocken (Pulbiber)
1/2 TL Kardamomsamen (ohne die umgebende Samenkapsel)*
1/2 TL Kreuzkümmelsamen*
1 TL Koriandersamen*
1/2 TL schwarze Pfefferkörner*
100 ml Olivenöl
* wenn gemahlen vorhanden, geht natürlich auch das.
Zuerst die Sauce. Dafür die Kräuter von dicken Stängeln befreien, Knoblauchzehen schälen und grob zerteilen. Die Chilischote von Stielansatz und Kerngehäuse befreien und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Die Gewürze gemeinsam in einem Mörser zerstoßen (oder die gemahlenen miteinander vermischen). Kräuter, Chili- und Knoblauchstücke, Zitronensaft/-schale, Olivenöl und Gewürze im Mixer fein pürieren, ggf. mit Salz/Pfeffer/Chilipulver nach eigener Schärfevorliebe pikant abschmecken und in ein Schälchen umfüllen.
Nun die Auberginen waschen, das untere und obere Ende (Stielansatz) knapp abschneiden und die Früchte in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Mit dem Salz in eine Schüssel geben und mit Wasser bedecken, alles gut vermischen, damit sich das Salz auflöst und 15 Minuten ziehen lassen. Dann das Wasser gut abgießen und die Auberginen leicht abtupfen.
Das dünne Bepudern mit Stärke geht am besten in einem dünnen Plastikbeutel (z.B. 5-Liter Knisterfolien-Müllbeutel). Auberginen und Stärke in den Beutel geben, den Beutel mit viel Luft drin zudrehen und die Auberginen in dem entstandenen Folienballon gleichmäßig umherbewegen. Auf einen großen Teller oder in eine trockene Schale kippen und dort zum Braten bereithalten.
ca. 5–10 mm hoch Olivenöl in einen Topf oder eine tiefe (Wok-)Pfanne geben und erhitzen, bis von einem hineingehaltenen hölzernen Zahnstocher kleine Bläschen aufsteigen. Die mit Stärke bepuderten Auberginen portionsweise flach hineinlegen und von beiden Seiten goldbraun braten (dauert je Seite etwa 5 Minuten). Die Scheiben sollten in der Pfanne nicht zu dicht aneinanderliegen, denn wenn sie sich beim Braten berühren, kleben sie durch die Stärke aneinander. Die fertig gebratenen Auberginenscheiben auf einem mit Küchenkrepp belegten Teller sammeln und bis zum Verzehr warmstellen. Durch das eingedrungene Salzwasser und die später dazu gereichte Sauce müssen die Auberginen nicht extra gewürzt werden!
Pro Portion einige reichliche Löffel Hummus auf einen Teller geben, einige Auberginenscheiben daneben/darauf portionieren und alles großzügig mit dem Zhoug-Dip beträufeln. Guten Appetit!