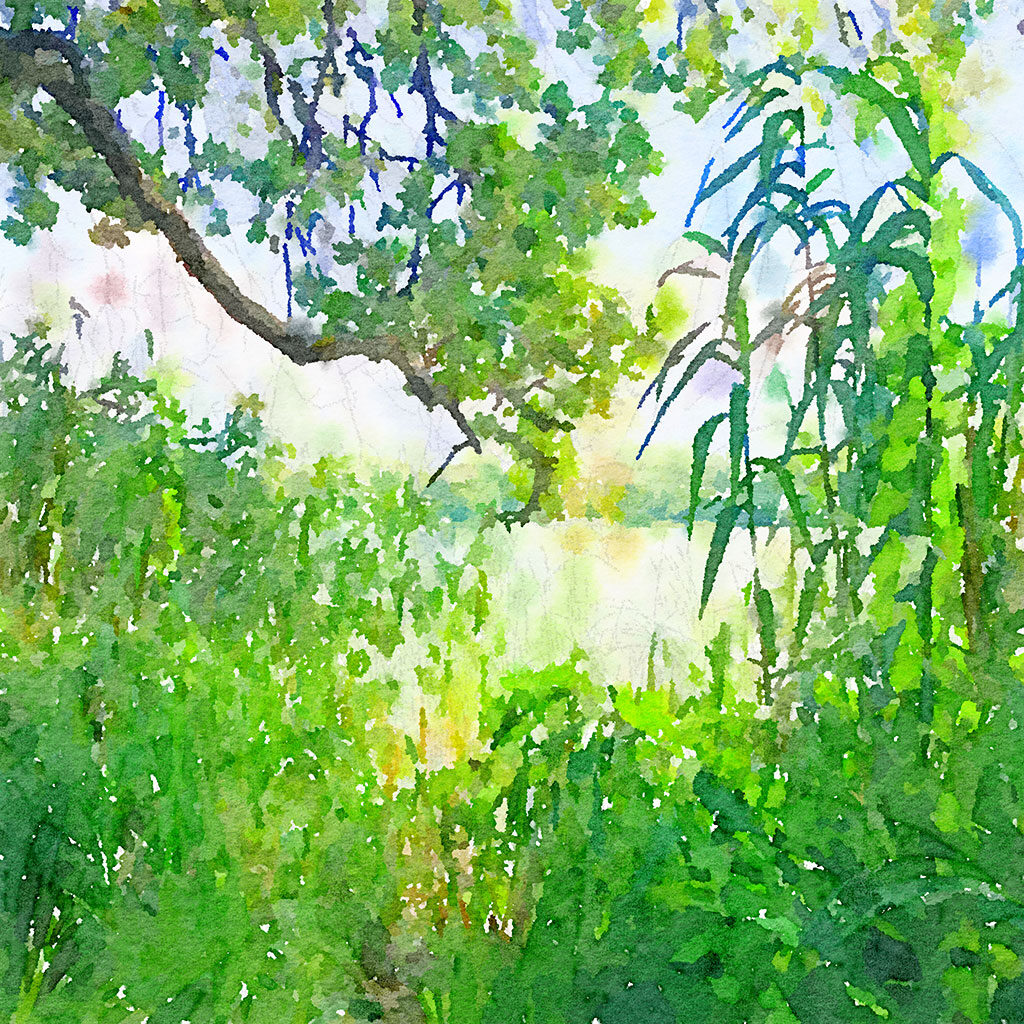Hallo, mein Name ist Thomas, ich bin jetzt 48 Jahre alt und kenne keinen Ort, kein Dorf, keine Stadt, die ich als meine »Heimat« bezeichnen würde.
Ich kenne Leute in meiner Familie, meinem Freundeskreis, unter Kollegen, bei denen dies anders ist – und ich vermute, das hängt sehr damit zusammen, wie und wo man aufgewachsen ist. Ich glaube, Heimat ist ein Gefühl, das sich durch das lange Verweilen an einem Ort (z.B. dem der Geburt oder Kindheit) verfestigt und durch häufige Ortswechsel, wie etwa Reisen oder Umzüge, auflöst. Ich lebe jetzt seit über zwanzig Jahren in Hamburg, weil ich hier einen tollen Job habe, weil ich die Stadt mag, weil das »Naturell« ihrer Bewohner dem meinen sehr ähnlich ist und weil ich hier Freunde habe.
Ja, ich fühle mich hier zu Hause. Aber ich könnte genausogut in Berlin, Leipzig, Stockholm, London, Amsterdam, Dublin oder Kopenhagen leben, um nur einige Städte zu nennen, die mir auch sehr gut gefallen.
Das Gefühl, keine geographische Heimat zu haben, hat seinen Ursprung in meiner Kindheit. Meine Großeltern kommen aus dem Südharz, aber auch sie wurden teilweise durch die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs dorthin verschlagen. Meine Eltern wurden zwar dort geboren, aber noch bevor ich das Licht der Welt erblickte, zogen sie (mit mir als Fötus im »Gepäck«) bereits das erste Mal um und so sollte ich im März 1967 rund 200 km vom Ort meiner Empfängnis geboren werden: in Friedberg, nördlich von Frankfurt/Main, wo mein Vater sein Studium absolvierte. Ich erinnere mich nicht mehr an meine ersten Lebensjahre in Hessen, ich habe nur Fotos von mir als pausbäckiges Kleinkind, die in jener Zeit aufgenommen wurden, aber meine Mutter erzählte mir, ich hätte im Zuge meiner sprachlichen Prägung sehr schnell das nachgestellte »Gell?« angenommen und als Kleinkind so quasi schon etwas vom hessischen Lokalkolorit assimiliert.
Der nächste Umzug, es muss um 1970 herum gewesen sein, führte uns zurück an den Rand des Harzes, nach Seesen, wo mein Vater seinen ersten Job nach dem Studium annahm. An diese Zeit habe ich tatsächlich rudimentäre Erinnerungen. Eines der Nachbarskinder, mit denen ich spielte, hieß Holger und von den Kinderspielen auf dem Innenhof trage ich noch heute ein »Souvenir« in Form einer haarlosen Narbe am Hinterkopf bei mir – ich war bei einer nicht sonderlich schlauen Variante des Fangenspielens – mit einer Spieldecke über dem Kopf – die Kellertreppe hinuntergefallen.
1972. Schon wieder umziehen. Diesmal nach Himmelsthür bei Hildesheim. Ich erinnere mich an Heckenrosen vor dem Haus, einen Spielkameraden namens Dirk, an Rosinenbrötchen vom umliegenden Bäcker. Da war ich fünf – und bekam eine Schwester.
1974 suchte mein Vater gezielt nach einer Anstellung im Ausland. Deutsche Ingenieure waren gesuchte Fachkräfte in aller Welt, die bei Bau- und Maschinenbautätigkeiten in vielen Regionen ihre Kenntnisse einbrachten und diese Jobs wurden gut bezahlt. Für die Kinder der »Auswanderer« stellten manche großen Firmen sogar eigene Kindergärten und Schulen auf die Beine. Und so hieß es 1975 erneut: umziehen! Diesmal übers Mittelmeer, ins französischsprachige Algerien, nahe der Stadt Constantine, die schon damals mehrere 100.000 Einwohner zählte. Es gab zwar ein eigens für die Facharbeiter der Firma errichtetes Wohngebiet, doch dieses war keineswegs wie ein Ghetto umzäunt.
Unsere Nachbarn waren Algerier, in deren Haus waren wir gelegentlich spontan zu Gast. Meine Eltern erzählten uns oft, wie fasziniert die Nachbarn und auch andere Einheimische von den weißblonden Haaren waren, die meine Schwester und ich zu dieser Zeit hatten. Von Algerien habe ich noch Erinnerungen an den Geschmack des selbstgebackenen Fladenbrotes der Nachbarsfamilie, an einen kleinen Bach jenseits der Straße, in dem Süßwasserkrabben, Frösche und Kaulquappen lebten, an Ausflüge in die Sahara, an Datteln, frisch von der Palme gepflückt und gegessen und an das Einkaufen in den wuseligen Basaren der Stadt, wo es nach Hammelfleisch, Brot, Abwasser und Gewürzen roch und an unsere junge Haushaltshilfe, Fatima, die außerhalb des Hauses immer schwarz verschleiert sein musste, und an ihre mit Henna rot gefärbten Handflächen.
Schon in der ersten Klasse hatte ich Französischunterricht, Madame Adas hieß meine Lehrerin und einer meiner besten Freunde hieß Ulrich. Es zerriss mir das Herz, als seine Eltern wieder aus der Nachbarschaft fortzogen mussten, zurück nach Deutschland oder in ein anderes Land, keine Ahnung. Mit 6 ist man noch zu jung für eine Brieffreundschaft, aber ich weiß noch: ich habe geweint.
Zurück nach Deutschland kamen wir 1975, es war wieder in der Nähe von Hildesheim. Eine neue Schule, neue Freunde, eine neue Wohnung. Auch einige meiner Mitschüler hatten offenbar Umzüge hinter sich, da waren zum Beispiel Mario aus Italien und zwei türkische Jungs, zweieiige Zwillinge, ihre Namen weiß ich nicht mehr. Zwei Jahre lang besuchte ich eine ganz normale Grundschule in Deutschland. Dann abermals: umziehen!
1977 nahm mein Vater erneut einen Job im Ausland an. Wieder Afrika, diesmal allerdings viel näher am Äquator. Nigeria hieß unser neues Ziel. Hier gab es eine übergreifende Deutsche Schule für die Kinder zugewanderter Arbeiter, aber es waren auch einige einheimische Kinder in den Klassen, meine Mathelehrerin war mit einem Nigerianer verheiratet, die Frau eines Kollegen meines Vaters und Nachbarn in unserem Wohnhaus, war Äthiopierin, ihre Kinder, Rodney und Colette, unsere Spielkameraden. Im Garten wuchsen Zuckerrohr, Papayas und Bananen, wenn wir als weiße Exoten zum Einkaufen oder bei Wochenendausflügen in ausschließlich von Schwarzen bewohnte Orte kamen, strömten oft Scharen von Kindern herbei und riefen »Oibo! Dash me!« (Weiße! Schenkt mir was!). Dass viele Einheimische nicht viel Geld hatten und die ausländischen Arbeiter im Vergleich merklich wohlhabender waren, äußerte sich nicht nur in diesen kleinen Aufläufen, sondern auch in gelegentlichen Überfällen und Einbrüchen auf Weiße bzw. in deren Wohnungen. Auch Bekannten unserer Familie passierte dies, wir aber hatten Glück.
Ich vermisste oft ganz banale Lebensmittel, die in Deutschland jeden Tag verfügbar waren: Mortadella, Schnittkäse oder Äpfel (dazu gibt es auch schon einen früheren Blogeintrag). Meine Oma ging derweil in Deutschland alle 14 Tage für mich zum Kiosk und kaufte für mich das neue YPS-Heft. Nur zweimal im Jahr maximal hatten wir einen freien Heimflug auf Firmenkosten nach Deutschland, die große Kiste YPS, die dann auf mich wartete, war jedesmal ein großes Highlight. Ich schloss neue Freundschaften, ging hier zwei Jahre zur Schule. 1979 zogen wir zurück nach Deutschland.
Das nächste Auslandziel war schon geplant: Venezuela. Anfang der Achtziger sollte es losgehen, der Arbeitsvertrag meines Vaters war schon unterzeichnet. Dann die Diagnose aus heiterem Himmel: Krebs. Kaum ein Jahr später war mein Vater tot, mit nur 37 Jahren. Ich war 14. Von nun an blieben wir eine lange Zeit in Deutschland.
Was geblieben ist von diesen vielen, oft schmerzhaften, aber auch unglaublich bereichernden Ortwechseln und Umzügen, ist die Gewissheit, dass ich überall leben könnte, wohin mich Menschen begleiten oder wo ich auf Menschen treffe, die ich mag, an denen mir etwas liegt, die mir verbunden sind, die mir Nähe geben. Heimat ist kein Ort, es ist ein Gefühl, eine Konstellation aus Geborgenheit, Zuversicht, Wohlbefinden und Freundschaft, vielleicht auch Liebe. Und es sind immer Menschen. Ohne sie kann kein Ort eine Heimat sein.
Heute lebe ich in Hamburg, dem »Tor zur Welt«. Ich finde es gut, dass dieses Tor zu beiden Seiten hin geöffnet ist, dass in meinem Viertel, in Barmbek, Geschäfte und Menschen aus zahllosen Ländern ansässig sind und dass ich in der Stadt auf Touristen und Einwohner aus allen Kontinenten treffe. Es spielt keine Rolle, ob sie hierhergezogen sind, hier geboren wurden, als Touristen zu Besuch, nur auf Zeit, des Jobs wegen oder aus Herzensangelegenheiten, ob sie bald wieder fortziehen oder Geflüchtete sind. Ich finde es selbstverständlich, dass meine Bekannten und Freunde Namen wie George, Nese oder Ario tragen und dass ich in meinem Job bisher unter anderem Serkan, Mehran, Monique, Jo, Poul Erik, Ngoc Minh und Ufuk begegnet bin. Diese Vielfalt ist ein unendlicher Reichtum – und ich möchte nie wieder so arm sein, wie diejenigen, die sich ihr verweigern.
Ich unterstütze die Initiative #BloggerFuerFluechtlinge und würde mich freuen, wenn auch einige meiner Blogleser sich mit einer Spende am Fundraising des Projekts beteiligen.

Wer auf seiner Seite ebenfalls ein Banner der Aktion einbinden möchte, kommt per Klick auf das Bild zum Blog tollabea.de, wo diese schöne visuelle Umsetzung entstand und in vielen Varianten frei zum Download bereitsteht.