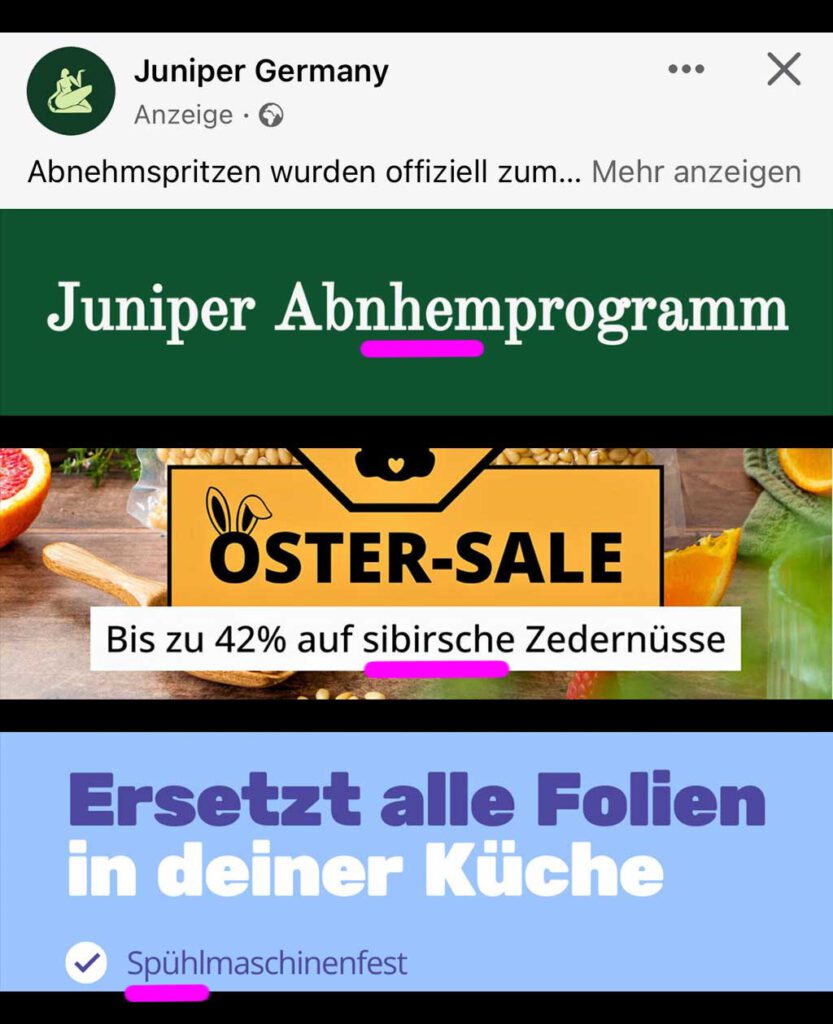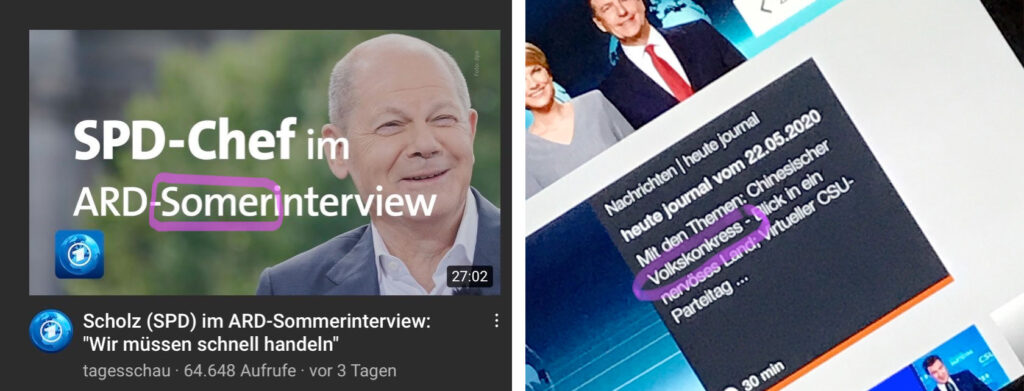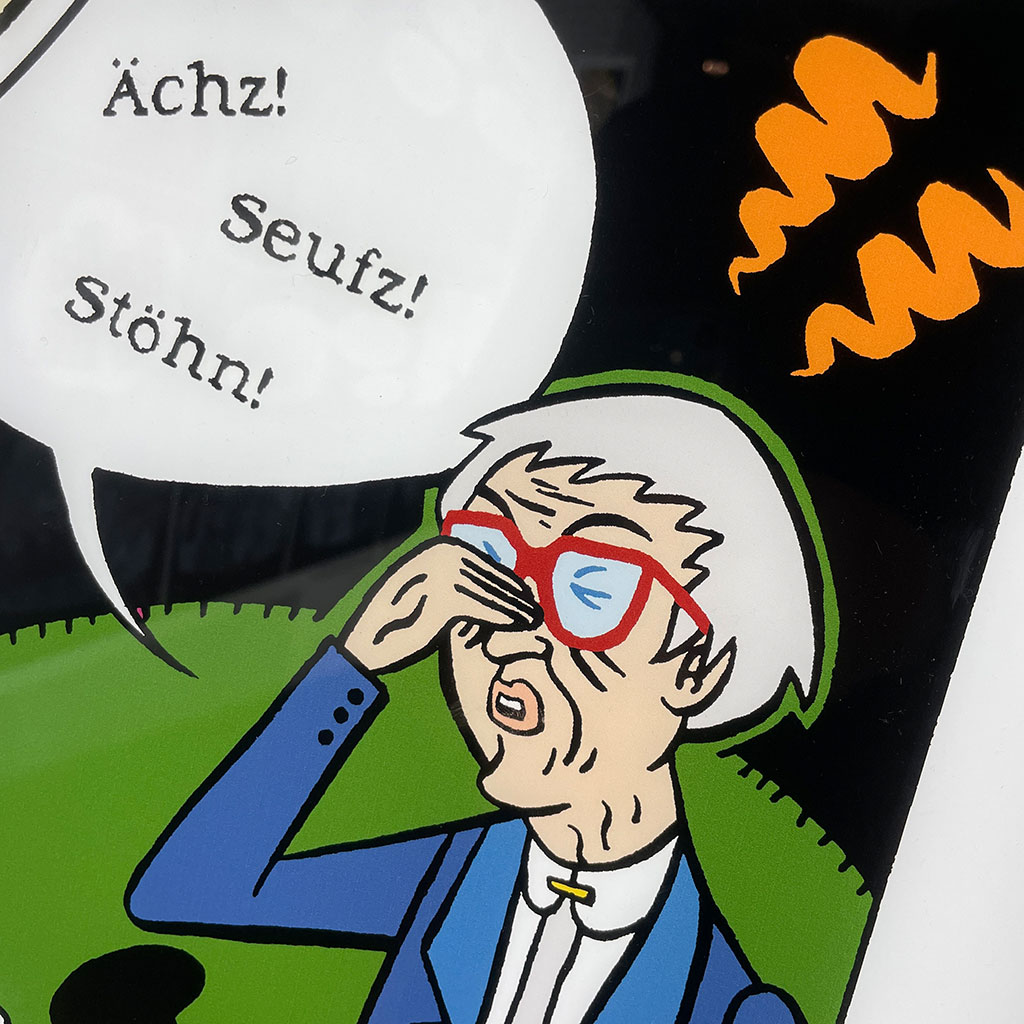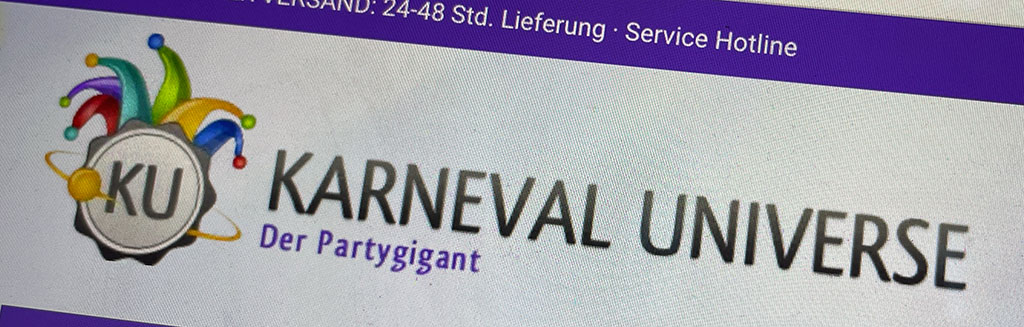Gestern Abend habe ich mir einen langgehegten Wunsch erfüllt und bin anlässlich meines Geburtstages mit dem Mann in einem Berliner Restaurant essen gegangen, welches nicht nur überwiegend sehr gute Bewertungen im Netz aufweisen kann, sondern auch eine besondere (fleischliche) Spezialität anbietet, nämlich Steaks vom »Wagyū-Rind«. Die Feinheiten zur Herkunft und Klassifizierung dieser Fleischsorte und zum Unterschied zwischen diesen Steaks und den noch kostspieligeren vom »Kobe-Rind« möchte ich hier nicht vertiefen, das würde den Rahmen und das Thema dieses Blogbeitrags sprengen. Ich achte zwar fortschreitend darauf, seltener und weniger Fleisch zu mir zu nehmen, vor allem das ausnehmend klimaschädliche Rindfleisch, aber als kulinarisch interessierter Esser wollte ich es zumindest einmal probiert haben. Ich hatte bereits geschluckt, als ich vor der Reservierung online in die Speisekarte lugte, aber durch eine außerplanmäßige finanzielle Zuwendung in den letzten Monaten rückte die Erfüllung meines Wunsches nun in eine durchführbare Nähe und der feierliche Anlass gab mir dann den finalen Impuls, ihn endlich in die Tat umzusetzen. Es war tatsächlich die höchste Rechnung, die ich nach einem »dinner for two« jemals in einem Restaurant beglichen habe und es war auch ein durchaus hervorragendes Menü. Meine Vorspeise, Thunfischtatar auf Avocadowürfeln in einem Jus aus Ponzu-Saft und geröstetem Sesamöl, schmeckte vortrefflich. Das Steak war außergewöhlich zart und saftig, die Gemüsebeilagen, die Knoblauch-Parmesan-Pommes und der Trüffelmayo-Dip delikat, der gewählte feinfruchtige Weißwein und der vollmundige Rotwein passten gut zum Essen, der Service war freundlich und prompt – es war ein rundum schöner Abend.

Es gab also eigentlich nichts zu beanstanden. Eigentlich. Denn wenn ich über die Details des Essens nachdachte, kam ich zu dem Schluss, dass ich einige der Bestandteile meiner Gerichte von früheren Mahlzeiten oder bei Gastronomiebesuchen zu anderen Anlässen und an anderen Orten als »besser« in Erinnerung habe. In der »Nordbornholms Røgeri«, einer Fischräucherei auf dieser schönen dänischen Insel, aß ich die in meiner Erinnerung bisher besten Pommes meines Lebens (siehe Bild am Ende des Beitrags), perfekt goldbraun in Erdnussöl frittiert, außen zartkross und innen saftig, und mit grobem lokalen Meersalz bestreut. Das bemerkenswerteste Steak, das ich jemals verzehrte, hatte ich tatsächlich selbst zubereitet, ausgewählt aus dem sehr gut sortierten Sortiment gereifter Steaks in der Fleischtheke eines EDEKA-Feinkostmarkts im etwas »feineren« Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Es schmeckte so unvergleichlich aromatisch »rindfleischig«, dass ich dieses Aroma als Messlatte bis heute auf der Zunge mit mir trage. Die Sauce Bearnaise, die der Mann zu seinem Gericht bestellt hatte, war fein emulgiert und definitiv hausgemacht, aber das Estragonaroma hatte ich in früheren Varianten schon intensiver und »runder« wahrgenommen. Ich verstand auch die »Idee« des verantwortlichen Kochs hinter der Pommeszubereitung, die frittierten Kartoffeln mit Parmesan und geröstetem Knoblauch auf eine neue geschmackliche Ebene heben zu wollen, aber bezüglich der Ausführung fand ich nach dem ersten Bissen, da gäbe es noch »Luft nach oben«. Ich will hier gar nicht auf hohem Niveau herummäkeln, vielmehr regte mich der gestrige Restaurantbesuch dazu an, darüber nachzudenken, was für mich eigentlich »gutes« oder Essen ausmacht oder was »besser« bedeutet, warum mir einige Mahlzeiten in der Vergangenheit so außergewöhnlich gut geschmeckt haben, warum ich mich noch nach Jahrzehnten an einzelne Zubereitungen oder Gerichte immer noch lebhaft erinnern kann und ob das alles wirklich immer zwingend mit dem Preis zusammenhängen muss, den man dafür bezahlt.
Meine Überlegungen, nach welchen Kriterien ich »Essen« beurteile, führten mich bislang zu fünf Achsen, die als persönliche Bewertungsskalen für mich dabei eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Sie überlappen sich zwar in einigen Aspekten, aber als grobes Raster funktionieren sie recht gut:
- Absolut gezahlter Preis
sehr gering < > für mich okay < > exorbitant hoch - Erhaltener Gegenwert/Zutaten/Zubereitung
begeisternd/besser als erwartet < > angemessen < > enttäuschend - Präsentation/Attitüde
lieblos/unoriginell < > einfach/unprätentiös < > aufwendig/meisterhaft < > protzig/übertrieben - Vertrautheit des Gerichts/der Rezeptur
mir zur Genüge bekannt < > gelegentlich schon gegessen < > für mich absolut neu/überraschend - Umgebung/Situation/Anlass
wertet den Genuss ab oder stört < > ist irrelevant < > wertet den Genuss auf
Den Service in einem Restaurant könnte man zwar als sechste Achse noch dazunehmen und er spielt auch für ein gastronomisches Gesamterlebnis m.E. eine wesentliche Rolle. Aber weil ich hier auch selbst zubereitetes Essen mit einbeziehe, lasse ich dieses Kriterium bewusst außen vor. Meine häufigste positive Erfahrung war, dass in Lokalen, die einem Hotel angegliedert sind, eine gute Servicekultur häufiger anzutreffen war als in solitären Restaurants. Die häufigste negative Erfahrung war, dass in Restaurants aller Preisklassen (auch dem gestern besuchten) den Servicekräften zu oft der Wille oder die Fähigkeit fehlt, mit einem 360°-Blick durch den Gastraum zu gehen und beispielsweise, wenn am Nebentisch abkassiert wurde, nach diesem Vorgang an allen umgebenden Tischen kurz zu prüfen, ob irgendwo sonst aktuell ein Servicebedarf besteht. Zeigen geleerte Gläser an, dass nachbestellt werden möchte? Schauen mich Gäste bedürftig an oder heben ihre Hand? Wie oft schon erlebte ich Kellner*innen, die mit schmalstdenkbarem Sichtfeld durch die Tischreihen schreiten, um sich an einem Tisch einer Aufgabe zu widmen, sich anschließend blind umzudrehen und schnurstracks Richtung Tresen/Küche abzutreten. Wieviel Umsatz und Gästewohlwollen durch dieses Defizit verlorengehen, möchte ich mir lieber nicht ausmalen.
Absolut gezahlter Preis – Muss gutes Essen viel Geld kosten?
Für mich beantworte ich diese Frage mit »nein«. Gutes Essen kann teuer sein, aber es muss nicht. Jeder gastronomische Betrieb und auch die Hersteller aller verwendeten Produkte und Zutaten möchten natürlich mit ihrem Erlös einen Gewinn erwirtschaften. Mir ist klar, dass ich somit bei einem auswärtigen Essen stets nicht nur den Gegenwert der Lebensmittel bezahle, sondern auch Raummiete, Personal, technische Betriebskosten usw. Viele Gastwirte pflegen, auf Getränke eine höhere Marge zu berechnen als auf die servierten Speisen, auch das ist absolut legitim, um mit gutem Essen auf seine Kosten zu kommen. Vom individuell ausgeprägten Gewinnstreben der Betreiber mal abgesehen, sind vermutlich die zwei häufigsten Optionen, um für »wenig Geld« sehr gut zu essen: erstens (z.B. im Urlaub) in einem Land zu speisen, in dem der Gast für seine heimische Währung einen außergewöhnlichen Gegenwert in lokalen Restaurants erhält, da ihm der vorteilhafte Wechselkurs dies ermöglicht. Da dieser Wertbetrachtung aber eine gewisse Verzerrung innewohnt, möchte ich mich bevorzugt der zweiten Option zuwenden: Man kann sehr gutes Essen für sehr wenig Geld genießen, wenn ein Gericht entweder sehr einfach zuzubereiten ist (und zudem gekonnt zubereitet wird!) bzw. wenn man für dessen Zubereitung nur sehr wenige Zutaten benötigt, die zudem auch in guter Qualität meist nicht viel kosten. Beispiel: eine Scheibe selbstgebackenen, noch ofenwarmen Brotes mit frischer Butter. Der Preis für Mehl, Wasser, Hefe und Salz ist vergleichsweise niedrig, ebenso die Kosten für den Strom, der zum Backen benötigt wird. Die Butter ist fast das Teuerste an dieser Speise, aber insgesamt gehört diese Köstlichkeit zu den kostengünstigsten Genüssen, die ich kenne. Weitere Beispiele für ebenso simple und kostengünstige wie köstliche Zubereitungen sind etwa Spaghetti aglio e olio, Misosuppe, Hummus oder Waldorfsalat. Bei eigener Zubereitung kann man den Preis zusätzlich senken, wenn man mit der saisonalen Verfügbarkeit z.B. der gebräuchlichsten Gemüsezutaten vertraut ist und diese bevorzugt dann einkauft und nutzt, wenn deren Preise auf ihrem Jahrestief sind. Es hilft aus meiner Sicht ohnehin, sich mit etwas Warenkunde und eigenem Kochwissen auszustatten, sowohl um selbst günstige Speisen zubereiten zu können als auch um die Qualität und den Gegenwert von außer Haus genossenen oder fertig gekauften Gerichten besser beurteilen zu können.
Gegenwert – Was bekomme ich für mein Geld?
Auf dieser Achse habe ich schon ein ziemlich breites Spektrum an Erfahrungen machen können. Ich möchte behaupten, dass inzwischen in vielen Fällen schon an der Speisekarte, die außen vor einem Restaurant aushängt, beurteilen kann, wie beseelt und phantasievoll in der Küche gearbeitet wird. Wenn ich bereits dort eine Ahnung bekomme, dass der Küchenchef sich mit Ausgangsprodukten, Würzungen, Aromen, Konsistenzen und Texturen auskennt, damit experimentiert und spielt und so einen Mehrwert für seine Gäste zu kreieren versucht, der über den Preis der Zutaten hinausgeht. Das gilt aber eher für Restaurants, die »neue« Gerichte kreieren. Wenn ich ein Restaurant besuche, das auf seiner Karte fast nur altbekannte »Klassiker« auflistet, bin ich auf Gästebewertungen im Netz angewiesen oder muss es selbst herausfinden. Denn hinter »Wiener Schnitzel«, »Gyros mit Zaziki und Pommes«, »Teriyaki-Ente« oder »Spaghetti Carbonara« kann sich so ziemlich alles verbergen. Das Schnitzel kann hauchdünn flachgeklopft, zart paniert und goldbraun frittiert auf dem Teller landen – oder als zäher Fladen mit fettglänzender brotig-dicker Panade. Die Pasta können al dente mit einem sämigen Film frischer, halbgestockter Eiermasse und feinen Streifen Guanciale-Speck serviert werden – oder man versteht in dem gewählten Restaurant darunter überkochte Nudeln mit einer breiigen Sahnesoße, in der Presskochschinkenwürfel schwimmen. Im schlimmsten Fall muss man für beide Extreme einen ähnlichen Preis bezahlen. Da ich einige dieser Klassiker schon in hervorragender Qualität probieren durfte, bestelle ich sie oft, um sie als »Visitenkarte der Küche« einzustufen. In einem chinesischen Restaurant ist nach meiner Erfahrung die (meist recht günstige) Wan-Tan-Suppe als Vorspeise ein guter Indikator für das Niveau der Restaurantküche insgesamt. Wenn eine aromatische, selbstgekochte Bouillon im Schälchen schwappt, mit hauchdünnen Teigtaschen, die mit fein gewürzter hausgemachter Hackmasse gefüllt sind und zwischen den kleinen Fettaugen auf der Suppe knackige Lauchzwiebelringe schwimmen, darf ich davon ausgehen, dass die Hingabe, die zu dieser Suppe führte, auch in die restlichen Vorspeisen und Hauptgerichte einfließt. In einer Eisdiele ist für mich das Straciatellaeis der Lackmustest, in einem Bistro oder Steakhaus der Caesar-Salat.
Die größten Enttäuschungen, an die ich mich erinnern kann, waren ein »Carpaccio vom Rind« vor Jahrzehnten in einem italienischen Restaurant in Hannover und ein knorpeliges, zähes Gulasch in einem Budapester Lokal, das ich im Nachhinein als »Touristenfalle« bezeichnen würde. Das Carpaccio bestand aus trocken servierten dünnen Scheiben Rinderfilet (immerhin), die mit getrockneter Petersilie aus der Streudose (!) und fertig geriebenem Tütenparmesan (!!) bestreut waren. Kein Salz, kein Pfeffer, kein Olivenöl, es war eine satte »Null« auf der Bewertungsskala. Da ich damals als junger Gast noch schüchterner mit offensiv geäußerter Kritik war, habe ich mich meiner Erinnerung nach nicht beschwert, sondern lediglich auf das Geben von Trinkgeld verzichtet. Das würde mir heute definitiv nicht mehr passieren.
Die größten Überraschungen erlebte ich fast immer dann, wenn ich ein sehr »simples« Gericht bestellte und die Zubereitung oder Produktqualität meine Erwartungen maximal übertraf. So ist mir bis heute ein Teller »gebratene Scampi mit Knoblauch« in Erinnerung geblieben, den ich auf einer Restaurantterrasse in einem Küstenstädtchen in der Toscana serviert bekam. Die Scampi waren riesig und so perfekt gebraten, dass man die Schale als rösche superdünne Kruste einfach mit verspeisen konnte, das Olivenöl, mit dem sie glasiert waren, hatte das fein-geröstete, karamellisierte Aroma der gebräunten Knoblauchscheiben assimiliert, die zwischen den Scampi lagen. Dazu etwas Salz und Pfeffer, zehn von zehn Punkten und ein unübertroffener »value for money«. In einem gutbürgerlichen Gasthof im Fichtelgebirge waren es kürzlich die sonst eher achtlos mitgemampften Kartoffelklöße, die meine Aufmerksamkeit weckten, da ich noch nie eine so feine, kartoffelige Zubereitung mit perfekter Konsistenz erlebt hatte. Manchmal sind es auch die kleinen »Dreingaben« des Restaurants zu den eigentlich bestellten Gerichten. Ich erinnere mich an manchen famosen Korb hausgebackenen Brotes, manchmal mit ebenfalls selbstgemachten originellen Dips oder Aufstrichen. Auch ein »Gruß aus der Küche« in einem Restaurant in der Nähe von Meißen darf da nicht unerwähnt bleiben: eine kleine Espressotasse mit einigen Löffeln einer tatsächlich mit Espresso versetzten, leicht schaumigen Hummerbisque. Diesen herrlichen Geschmack aus Krustentier und Kaffee werde ich niemals vergessen. Wenn ich Enthusiasmus, Phantasie und Kompetenz, auch bei den einfachsten Speisen, erschmecken kann, dann bekomme ich meistens mehr, als ich anschließend mit meinem Geld vergüte.
Präsentation – Die »Show« vom Ambiente bis zum Teller
Ein weites Feld ist auch diese Bewertungsachse. Oft beginnt es schon bei der Eigenwerbung auf der Website des Restaurants. Die Information, nach der ich auf Restaurantwebsites bisher am häufigsten suchen musste, betraf *Tusch!* – die Öffnungszeiten. Stehen sie auf jeder Unterseite im Footer? Stehen sie bei »Wir über uns«? Bei »Reservieren«? Bei »Kontakt«? Werden sie womöglich überhaupt nicht auf der Website genannt, sondern nur im Google-Maps-Eintrag? Und stimmen sie? Sind Ruhetage, Urlaube, vorübergehende saisonale Schließungen korrekt und aktuell hinterlegt? Nicht selten habe ich trotz aufgespürter Angaben dann später vor verschlossenen Türen gestanden oder die Website frustriert verlassen und mich anderen Lokalitäten zugewandt. Dann eben nicht.
Wie präsentiert sich das Restaurant insgesamt gegenüber prospektiven Gästen? Oft findet sich irgendwo online oder im Vorwort der Speisekarte ein Absatz mit der Überschrift »Unsere Philosophie«. Da steht dann was von frischen Zutaten, aufmerksamem Service, Gastlichkeit und so weiter. Meistens aber wären diese Texte zwischen verschiedenen Restaurants ohne Weiteres austauschbar. Entweder sind es blumig formulierte Selbstverständlichkeiten oder die nachfolgende Auflistung der tatsächlich bestellbaren Gerichte und Zutaten ist bei der Vorabbewertung des Lokals weitaus hilfreicher. Auf der Suche nach einem guten Berliner Steakhaus für mein anfangs erwähntes Geburtstagsdinner stieß ich auf ein Restaurant, das dem Thema »Exklusivität« eine ganz neue Facette hinzufügte. »Willkommen im Goldhorn‑Beefclub Berlin, einem der exklusivsten Beefclubs der Welt« stand auf der Website zu lesen. Aha, dachte ich, da kann man dann wohl nur speisen, wenn man diesem »Club« als Mitglied beitritt? Doch kurz darauf wurde ein Banner eingeblendet »Kein Mitglied? Kein Problem! Reservieren Sie einfach links auf Quandoo. Sie erhalten so eine kostenlose 24 h Mitgliedschaft«. Also »super exklusiv, aber eigentlich kann jeder zu uns kommen«. Mhm, soso, aha, naja, nundenn. Auch die sonderbare Verknüpfung zwischen gegrilltem Fleisch und der Definition von »Männlichkeit«, die in einem Bildmotiv der Seite zum Ausdruck kommt, wo ein Kleinkind neben einem Steak mit der Zeile »SO WERDEN MÄNNER GEMACHT« zu sehen war, mutete mir seltsam an. Da wollte ich nicht essen.
Da ich den Konzepten »Überkonsum« und »exzessiver materieller Luxus« eher skeptisch gegenüberstehe, sprechen mich auch Restaurants, die ihre vermeintliche Exklusivität durch kulinarische, innenarchitektonische oder präsentationsbezogene Luxuskomponenten zu pimpen versuchen, in keinster Weise an. Diese Dubaiattitüde à la »alles muss golden glänzen oder mit Glitzersteinen beklebt sein«, »was kostet die Welt, wir fliegen Wasser in die Wüste, bauen Inseln ins Meer, wo vorher keine waren, jedes unserer Autos/Häuser/Yachten kostet mehr, als ein Durchschnittsmensch in Jahrzehnten verdient«, die mit Luxusmarken-Logos bepflasterten Taschen, Koffer, Jacken, Mäntel, all das wirkt auf mich derart aus der Zeit gefallen, monströs und in Zeiten der Klimakrise maximal unangemessen, dass es mich eher abstößt. »Der Champagner floss in Strömen«, heißt es ja bisweilen. Aber warum sollte er das? Das zentrale Kennzeichen des Besonderen ist es doch, dass es etwas Besonderes ist. Wenn es jederzeit in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht und jeden Tag übermäßig konsumiert werden kann, ist es doch eigentlich nur noch so besonders wie Rübenzucker. In diesem Zusammenhang las ich von einer pseudoprominenten Person, die ebenfalls ein oder mehrere »edle« Steakhäuser betreibt, wo manche der servierten Fleischgerichte großzügig mit Blattgold belegt werden. Zusätzlich wird wohl bei Tisch einer Art »Gewürzchoreographie« zelebriert, bei der das aufgetragene Fleisch mit flamencoähnlichen Armbewegungen aus großer Höhe mit grobem Salz bestreut wird. Meine Braue hebt sich. Große Fleischstücke nur der Show halber vollflächig mit Blattgold zu »garnieren«, das dann – pardon – am nächsten Tag wieder ausgekackt und weggespült wird – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, diesem gastronomischen Auswuchs und der Scheißegalhaltung dahinter die Bezeichnung »Luxus« abzusprechen. Und die ponyhohen Pfeffermühlen in manchen Restaurants fand ich schon früher albern, da brauch’ ich nicht noch einen Salztanz.
Ich habe überhaupt nichts gegen eine edle, kultivierte, exklusive Atmosphäre oder Speisenpräsentation, aber – vielleicht fühle ich mich auch seit fast 30 Jahren deshalb in meinem Wohnort Hamburg so wohl – gerne mit Understatement, Stilgefühl und Dezenz. Ich mag es z.B., wenn bei einer Suppe zuerst der Teller mit der warmen Einlage auf den Tisch gestellt wird und die Servicekraft dann aus einer Kanne die flüssige Suppe dazugießt. Mir gefällt gut gestaltetes Geschirr, es muss kein Luxusporzellan sein, auch Steingut oder Keramik mit dem Charme und den leichten Unregelmäßigkeiten einer Handfertigung kann sehr stilvoll sein. Dunkel erinnere ich mich an den Besuch eines Restaurants (vielleicht war es Schaarschmidts Restaurant in Leipzig), dessen Gasträume mehrere verschachtelte kleine Zimmer waren, die mit dunklen Holzmöbeln und hohen Bücherregalen wie »Omas Wohnzimmer« eingerichtet waren und wo jedes Gedeck, jeder Teller unterschiedlich waren. Es wirkte tatsächlich, als würden die Speisen auf dem über Jahrzehnte angesammelten Geschirr aus dem Bestand einer Großmutter serviert – und es passte perfekt zu dem umgebenden Ambiente. Für mich müssen im Januar auch keine Deko-Erdbeeren oder -Johannisbeeren am Tellerrand liegen, die saisonfern von sonstwoher eingeflogen wurden und im schlimmsten Fall nicht mitgegessen, sondern nach dem Abräumen weggeworfen werden. Vermissen würde ich auch nicht den Industriebalsamicosirup, mit dem allzu gern Tellerränder oder Gerichte beschnörkelt werden. Die einzeln auf einem Stück Fisch oder Fleisch platzierte Ranke einer Erbsensprosse oder eine dekorativ eingesteckte Parmesanhippe erfreuen das Auge ebenso. Less is more, Unmaß, geh weg.
Und last not least habe ich auch schon hervorragend in Restaurants gegessen, in denen überhaupt kein Augenmerk auf die Präsentation oder das Ambiente gerichtet wurde. Ich erinnere mich an ein komplett weiß gefliestes Lokal mit eiskalt gleißender Neonbeleuchtung und kunststoffgepolstertem Küchengestühl in Portugal. Der Anblick des Gastraumes geriet aber schnell zur Nebensache angesichts der hervorragenden »Lulas grelhadas«, die dort zubereitet und aufgetragen wurden: fangfrische Calamari-Tuben, auf dem Grill gebräunt, mit Zitrone, Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt, dazu Olivenöl und einfache Salzkartoffeln mit Petersilie, serviert auf einem schmucklosen weißen Porzellanteller. Perfekt!
Eine gelungene, stimmige und unprätentiöse Präsentation kann den Genuss eines guten Essens deutlich aufwerten, aber aus einem uninspirierten oder minderwertigen Gericht kein Festmahl machen. Die Puzzleteile müssen sich authentisch ineinanderfügen. Prunk, Protz und Attitüde sollten das verzehrte Mahl, auch wenn es mit Können und Hingabe komponiert und zubereitet wurde, nicht übertrumpfen. Ich persönlich mag es, wenn das Essen die Hauptrolle spielt und nicht bloß Statist in einer überbordenden Gastro-Show ist, die allzu oft nur entweder dem Reibach oder der Ablenkung dient.
Vertrautheit – wieviel macht der Reiz des Neuen aus?
Vielen der erinnerungswürdigsten Speisen meines Lebens begegnete ich in einem Moment, wo ich dergleichen zum allerersten Mal überhaupt aß. Das oben bereits erwähnte schlechteste Rindercarpaccio ever war tatsächlich eine Enttäuschung, die zeitlich sehr dicht auf meine allererste Begegnung mit diesem Klassiker der italienischen Antipasti folgte. Ich war von einem der Chefs der Werbeagentur, in der ich während meines Designstudiums als »Freier« nebenbei arbeitete, zum Abendessen in Frankfurt/Main eingeladen worden, weil ich ihm als Fahrer am Steuer eines Lieferwagens helfen sollte, einige Möbelstücke von dort aus einem aufgelösten Zweitbüro abzuholen und zum Agentursitz nach Hildesheim zurückzutransportieren. Sein Lieblingsitaliener, sagte er, sei das besuchte Restaurant und ich könne bestellen, was immer ich wollte. Und so probierte ich mein allererstes Carpaccio – es war ein Gedicht. Hauchzarte rohe Rinderfiletscheiben, mit gutem Olivenöl und Zitrone beträufelt, dazu frisch gehobelter Parmesan, dünn geschnittene Champignons und etwas Rucola. Ich war begeistert und habe diese Komposition seither schon einige Male zu Hause nachempfunden. An mein damals gewähltes Hauptgericht erinnere ich mich nicht. Auch meine erste Begegnung mit der indischen Küche war eine Offenbarung, die ich während einer Studienreise nach Chicago, gemeinsam mit einigen Kommilitonen, erlebte. Seit meinem damaligen »Chicken Tikka Masala« bin ich der indischen Küche verfallen und diese Gaumenliebe hält bis heute unvermindert an. Oder mein erstes Hummus, serviert als eins von vielen kleinen Gedecken einer üppigen Mazza-Platte im Restaurant Saliba in Hamburg. Der nussige Geschmack, die cremige Konsistenz, die Gewürze darin – noch nie zuvor hatte ich so etwas vorher geschmeckt. Die anderen Kompositionen waren ebenso fulminant: gebratenes Lammhack mit Zimt und gerösteten Pinienkernen, rauchiges Auberginenpüree, zitroniges Tabouleh – ich betrat bei dieser ersten Begegnung mit der syrisch/libanesischen Küche eine komplett neue Welt, die ebenfalls bis heute zu meinen Lieblingsländerküchen gehört.
Es liegt vermutlich in der Natur der Jugendjahre, dass man in den ersten 10 bis vielleicht 30 Jahren seines Lebens sehr viel häufiger mit neuen Genüssen und Speisen konfrontiert wird als in höherem Alter – es sei denn, man legt es zeit seines Lebens darauf an, auch weiterhin bewusst ständig Neues zu probieren. Ich glaube, der Erstkontakt mit einem neuen Gericht hat immer das Potenzial zu einer besonders nachhaltigen Prägung – das kann sowohl im Positiven als auch im Negativen stattfinden. Schade ist es, wenn ein erstmals probiertes Gericht allein aufgrund von Fehlern oder Defiziten bei der Zubereitung als missliebig bewertet wird und man daraus pauschal die Konsequenz zieht, dieses nie wieder zu essen. Damit werden oft viele Chancen der Rehabilitation einer Speise vertan, die, in einer versierten Küche zubereitet, den einstigen Skeptiker womöglich geschmacklich überzeugen, begeistern und zurückgewinnen könnte.
Ist ein Gericht, eine Zubereitung oder eine Länderküche vertraut und auf dem Tisch steht die hundertste Currywurst, das hundertste Sushigedeck, die hundertste Bolognese, dann erschöpft sich der Neuigkeitswert dieser Speise und ihres Beeindruckungspotenzials fast nur noch in Nuancen. Wenn man diesen trotzdem Aufmerksamkeit schenken will und kann, muss Essen dadurch keineswegs langweiliger werden, denn auch die bewusste Suche nach der »Best of«-Zubereitung eines eigentlich zur Genüge vertrauten Gerichts kann durchaus aufregend und sehr schmackhaft sein. Ich versuche selbst, etwa beim Brotbacken oder beim Zubereiten von Hummus, stetig besser zu werden, meine Rezepturen und Praktiken zu verfeinern und habe viel Spaß daran. Aber einen solchen kulinarischen »Flash« wie bei der Verkostung meines ersten Carpaccio erlebe ich nach wie vor selten.
Natürlich will ich den wiederholten Genuss der Lieblingsspeise, idealerweise jedes Mal in genau derselben bevorzugten Zubereitungsweise, keineswegs abwerten. Es ist etwas Wunderbares, wenn ein Gericht, das man liebt und sein Leben lang immer und immer wieder gerne genießt, endlich mal wieder auf dem Tisch stehen kann, insbesondere, wenn man schon seit längerem mal wieder Appetit darauf hatte. Meine Mutter fragt mich immer, welches meiner Leibgerichte aus ihrem Repertoire sie kochen soll, wenn ich meinen nächsten Familienbesuch avisiere. Es gibt vier bis fünf Gerichte, die ich selber noch nie exakt so hinbekommen habe wie sie: Hühnerfrikassee, Kohlrouladen, Gulasch mit Nudeln und grüner Bohneneintopf. Jedes Mal ein Hochgenuss, aber die Erinnerung an die einzelnen wiederkehrenden Verzehrmomente wird vermutlich nicht immer derart klar auf einen bestimmten Zeitpunkt hin erinnert werden können wie bei den oben genannten geschmacklichen Erstkontakten.
Situation – wo, wann und warum wird gegessen?
Vermutlich kennen es einige: Ein lauer Sommerabend in südlichen Gefilden, ein kleiner Tisch auf der Außenterrasse eines kleinen Dorfrestaurants, pfirsichfarbene Reste von Abendrot säumen den Horizont, am Zenit des Himmelsgewölbes erscheinen die ersten Sterne, Grillen zirpen, das Geräusch eines Motorrollers und Gesprächsfetzen aus den umgebenden Gassen, leise Musik … und der rote Wein im Glas schmeckt so gut wie noch nie ein Rotwein geschmeckt hat. Der Ober oder die Speisekarte werden konsultiert, um zu erinnern, wie das feine Gewächs heißt, der Name wird notiert, vielleicht das Etikett der Flasche abfotografiert. Wieder daheim, wird das Internet umgestülpt auf der Suche nach diesem fantastischen Tropfen. Endlich – ein kleiner Weinhändler bietet den gesuchten Roten feil, er wird bestellt und bald schon freudestrahlend dem Postpaket enthoben.
Bei mir ging es anschließend zumeist auf zwei Pfaden weiter: Entweder verstaubte die rare Anschaffung im Regal, da ich allzu zögerlich auf einen Anlass wartete, der es wert wäre, endlich dieses alkoholische Souvenir zu dekantieren und wenn der Landwein dann doch endlich nach acht oder zehn Jahren im Glas landet, ist die rubinrote Farbe längst einem lebrigen Braun gewichen und er durch Überlagerung ungenießbar geworden. Oder er wird recht zeitig geöffnet, vielleicht ein den damaligen Urlaub assoziierendes Menü gezaubert, idealerweise stimmt sogar die Jahreszeit und es kann auf dem Balkon gespeist werden. Doch der erste Schluck entzaubert das Mitbringsel als einen bestenfalls durchschnittlichen Rebensaft, der in jedem Supermarkt für 3,99 in gleicher Qualität zu erstehen wäre. Es war nicht der Wein, der an jenem wunderbaren Abend so famos, so rund, aromatisch, so perfekt war, sondern die damalige Situation, die so berauschend empfundene Umgebung mit all ihren sensorischen und emotionalen Reizen.
Eine zweite Anekdote, die daran anknüpft, habe ich während meines ersten Urlaubs in der Toskana erlebt: Die (deutsche) Besitzerin der damaligen Ferienunterkunft, eines kleinen alten Häuschens in der Nähe des Ortes Greve, hatte für unsere etwa sechs Personen umfassende »Clique« einen italienischen Abend mit einem Menü unter freiem Himmel im Garten des Anwesens ausgerichtet. Es gab wunderbare hausgemachte Antipasti, köstliche Pastagerichte, delikaten Salat und hervorragenden Wein. Alle waren beseelt, dieses Dinner war einfach perfekt – die warme Abendbrise, die Landschaft, die Unterkunft, das Essen. Als Digestif servierte die Hausherrin für alle, die wollten, eine Runde Grappa. Auch dieser wurde hoch gelobt »super aromatisch«, »lecker«, »sowas kriegt man eben nur hier in Italien«. Doch die Gastgeberin wartete mit einer Pointe auf, mit der niemand am Tisch gerechnet hatte: »Nee, den bringe ich immer von ALDI mit, wenn ich nach Deutschland fliege. So einen guten habe ich hier noch nicht gefunden.«
Der Einfluss der jeweiligen Situation darauf, wie gut ein Essen schmeckt – ob in einem Restaurant oder selbst zubereitet – kann meiner Erfahrung nach riesig sein. Welcher Anlass liegt dem Essen zugrunde – ist es ein Candlelight-Dinner, ein Familienfest, die eigene Hochzeit oder der lang ersehnte Traumurlaub? Wo wird das Essen verzehrt – an einer romantischen Hafenpromenade, in freier Natur bei einem einsamen Picknick, im Restaurant auf der Dachterrasse eines Wolkenkratzers oder im Bordrestaurant eines Schiffs? Wer leistet mir beim Essen Gesellschaft – der/die Geliebte, die Eltern, alte, womöglich lang nicht getroffene Freunde? Die Endorphine, die während solcher Stunden ausgeschüttet werden, können allerhand objektive Unzulänglichkeiten bei Geschmack und Qualität der genossenen Speisen und Getränke glattbügeln oder sogar ins Gegenteil verkehren, davon bin ich überzeugt. Genauso können unangenehme Umstände – schlechter Service, ein Streit unter den Gästen, penetrante Gesellschaft am Nachbartisch, eine verstopfte Gästetoilette oder andere Stressfaktoren – einen kulinarisch eigentlich nicht zu beanstandenden Restaurantbesuch zur gefühlten und dauerhaft als solche erinnerten Katastrophe brandmarken.
Ich bin überzeugt, man schmeckt nicht nur mit Zunge, Nase und Gaumen, es sind alle Sinne, die beim Genuss eines guten, köstlichen und erinnerungswürdigen Mahls involviert sind und noch viele weitere Faktoren. Essen ist eine ganzheitliche Erfahrung, manche der Voraussetzungen dafür kann man trainieren oder erlernen, einige kann man kontrollieren oder zu organisieren versuchen, aber andere bleiben schlicht dem Zufall überlassen.
Bestimmt habe ich beim Nachdenken über gutes Essen noch einiges vergessen oder außer Acht gelassen. Ich freue mich wie immer über Ergänzungen, eigene Gedanken, Widersprechen oder Richtigstellungen in den Kommentaren und wünsche allzeit guten Appetit!